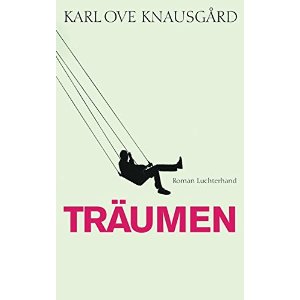 „Mein Herz war jung und stark, es würde für mich all die Jahre von zwanzig bis dreißig, von dreißig bis vierzig, von vierzig bis fünfzig, von fünfzig bis sechzig hindurch schlagen. Wenn ich genauso alt wurde wie Großvater, er war achtzig, hatte ich bis jetzt nur ein Viertel meines Lebens verbraucht. Fast alles lag noch vor mir, in das hoffnungsvolle Licht des Ungewissen und Offenen getaucht, und durch alles würde das Herz, dieser treue Muskel, mich heil und unverletzt bringen, stetig stärker, stetig klüger, stetig reicher an gelebtem Leben.“ Das ist die Stimmung, mit der der junge, neunzehnjährige Karl Ove im Jahre 1988 nach Bergen kommt, um an einer Schreibakademie zu lernen, wie man ein Dichter wird. Mitten im berauschenden Gefühl eines prallen Lebens, mit Cafés, Kunst, Kultur und schönen Frauen möchte er die Welt umarmen. Doch dann scheitert seine Liebe zur schönen Ingvild, und er fällt in ein bodenloses Loch. Womit wir schon beim Grundrhythmus des Buches wären. Die Amplitude von Rausch, Erwartung Enttäuschung, Depression, Selbstzweifel mit anschließendem Besäufnis durchzieht das ganze Buch wie ein literarischer Fingerabdruck, und niemand wird diese minuziöse Rekonstruktion einer intellektuellen Pubertät lesen könne, ohne sich nicht an die eigne Studienzeit erinnert zu fühlen. Möglicherweise stellt dieses „Wiedererkennen“ eigener Werdegänge, wie es sich für den Leser in allen Knausgard-Büchern darstellt, einen der Hauptgründe für den immensen Erfolg des Autors dar.
„Mein Herz war jung und stark, es würde für mich all die Jahre von zwanzig bis dreißig, von dreißig bis vierzig, von vierzig bis fünfzig, von fünfzig bis sechzig hindurch schlagen. Wenn ich genauso alt wurde wie Großvater, er war achtzig, hatte ich bis jetzt nur ein Viertel meines Lebens verbraucht. Fast alles lag noch vor mir, in das hoffnungsvolle Licht des Ungewissen und Offenen getaucht, und durch alles würde das Herz, dieser treue Muskel, mich heil und unverletzt bringen, stetig stärker, stetig klüger, stetig reicher an gelebtem Leben.“ Das ist die Stimmung, mit der der junge, neunzehnjährige Karl Ove im Jahre 1988 nach Bergen kommt, um an einer Schreibakademie zu lernen, wie man ein Dichter wird. Mitten im berauschenden Gefühl eines prallen Lebens, mit Cafés, Kunst, Kultur und schönen Frauen möchte er die Welt umarmen. Doch dann scheitert seine Liebe zur schönen Ingvild, und er fällt in ein bodenloses Loch. Womit wir schon beim Grundrhythmus des Buches wären. Die Amplitude von Rausch, Erwartung Enttäuschung, Depression, Selbstzweifel mit anschließendem Besäufnis durchzieht das ganze Buch wie ein literarischer Fingerabdruck, und niemand wird diese minuziöse Rekonstruktion einer intellektuellen Pubertät lesen könne, ohne sich nicht an die eigne Studienzeit erinnert zu fühlen. Möglicherweise stellt dieses „Wiedererkennen“ eigener Werdegänge, wie es sich für den Leser in allen Knausgard-Büchern darstellt, einen der Hauptgründe für den immensen Erfolg des Autors dar.
Das Buch beginnt im ersten Teil allerdings mit einem Misserfolg. Karl Ove gelingt es nicht, an der Schreibakademie zu reüssieren, einem extrem modernistischen Institut, in dem es zuerst und vor allem um Originalität geht und das bloße Erzählenwollen verpönt ist. Dabei gerade das Erzählen das Schwerste, wie jeder Leser weis und genau das, was der junge Karl-Ove kann, ohne seine rein erzählerische Begabung angemessen zu schätzen. Geradezu unübersehbar ist die Zahl der Autoren und Musiker, mit denen sich der junge Karl-Ove beschäftigt, was analytisch und reflexiv daherkommt, wegen der starken Bezüge zur skandinavischen Kultur jedoch etwas zu breit getreten erscheint. Schon recht früh fällt auf, wie Knausgard mit Parallelen und Entgegensetzungen arbeitet, etwa wenn er Hamsuns „Hunger“ liest und durch die Stadt läuft und Hunger hat. Oder wenn er in tadelloser Diktion brillant darüber räsoniert, warum er nie ein guter Schriftsteller werden wird. Eine weitere Entgegensetzung besteht in der Konfrontation des bäuerlichen Landes, wo er bei seinen Großeltern Ruhe und Zeitlosigkeit genießt, und der Stadt Bergen, in der Rasanz, Überraschung und Hektik dominieren. Jenseits dieser Technik verwendet Knausgard viel Mühe auf die Kennzeichnung der Charaktere, die ihm begegnen. Es sind jede Menge, und doch bleiben sie beim Leser erstaunlich haften, weil es dem Autor gelingt, sie als lebenspralle und unverwechselbare Figuren zu gestalten. Wenn es ein Kennzeichen guter Literatur ist, dass die Figuren „stimmen“, dann sind die Knausgard-Bücher geradezu ein Maßstab für gelungene Literatur. Das gleiche trifft für Stimmungen und Schauplätze zu. Über Bergen heißt es an einer Stelle: “Der Himmel war unerschöpflich, seit Anfang September hatte es täglich geregnet: mit Ausnahme einiger Stunden hatte ich seit fast acht Monaten keine Sonne mehr gesehen. Die Straßen waren fast vollständig verwaist, und wer sich auf ihnen bewegte, tat es so schnell wie möglich und dicht an den Häuserwänden bleibend.“ Auch die Beschreibungen der Fjordlandschaften, der Stadt Reykjavik oder Englands besitzen reiseliterarische Prägnanz.
Im Vergleich zu den Personen und Stimmungen tritt demgegenüber die Wichtigkeit der Handlung in den Hintergrund. Nur soviel: Das Milieu, in dem sich der Autor sich bewegt, ist bis in die Kapillargefäße hinein links geprägt, man lebt in freier Libertinage, wechselt die Partner wie die Wohnungen, nimmt offenherzig unbekannte Migranten mit in seine Wohnung um zu feiern und zuckt nur mit den Schultern, wenn man anschließend feststellen muss, dass man bestohlen worden ist. Man hütet sich davor, einen Frau „hässlich“ zu nenne, auch wenn sie hässlich ist, und glaubt allen Ernstes, dass James Joyce und Mickey Mouse die gleiche Wertigkeit besitzen. Das alles aber wird nicht affirmativ sondern mit Distanz beschrieben, etwa wenn er seine Begegnung mit Kriegsdienstverweigerern darstellt, die in Wahrheit nur kiffen wollen und bis in die Socken hinein asozial sind. Karl Ove schmeist das Studium, arbeitet in einem Pflegeheim und hält sich zeitweise in Island und England auf, spielt mit seinem Bruder in der Band „Kafkafilter“, ist ständig pleite und wandert von einer Frau zur nächsten, von Ingvild zu Gunvor, von Gunvor zu Tonje, die übrigens am Beginn von „Lieben“, einem Vorgängerband von „Träumen“, auch schon wieder passé ist. Sein Verhältnis zu Männern besitzt übrigens eigenartig bündische Züge, das heißt, er sucht bei Männern Gemeinschaft, Gefolgschaft und Austausch, von tiefergehendem geistigen Austausch mit Frauen ist in dem Buch nicht die Rede.
Am Ende, nach einigen hundert Seiten, auch das soll nicht verschwiegen werden, erschlafft der Leser ein wenig. So haben es mir viele berichtet, die das Buch gelesen haben, und mir ging es ebenso. Ein wenig war es wie bei einer Bruckner Sinfonie, die stark und großartig daherkommt, aber nach der mehrfachen Explikation aller Motive sich auch schwertut , ein Ende zu finden. Aber der Autor will gar kein Ende finden. „Ich wollte schreiben“, schreibt er, „das war das einzige, was ich wollte, und ich konnte all jene nicht verstehen, die es nicht wollten, wie konnten sie sich mit einem gewöhnlichen Job zufriedengeben, ganz gleich wie dieser Job aussehen mochte?“ Eben. Aus diesem Impuls speist sich das epische Mammutprojekt, das mit dem Abschluss des vorliegenden Buches noch lange nicht zu Ende ist. Macht aber nichts. Nach einem kurzen Knausgard-Moratorium bin ich bereit für den nächsten Band.