DIE SONNE SCHEINT ÜBERALL
Ein Besuch auf der Frankfurter Buchmesse am Freitag, dem 16.10.2019
Dieses Jahr war erste Mal, dass ich ernsthaft überlegte, nicht zur Buchmesse zu fahren. Die Ausgrenzungen gegen Andersdenkende, die unter der Ägide des Buchmessendirektors Jürgen Boos und anderer Feinde der Meinungsfreiheit auch in diesem Jahr wieder Platz gegriffen haben, verleideten mir den Messebesuch. So viel Gerede um Vielfalt, Toleranz und Meinungsfreiheit – und dann ein derartig rigides Umspringen mit Ausscherern aus dem linken Toleranzkorridor, das konnte glatt trübsinnig machen. Auf der anderen Seite würde das Fernbleiben von mir und Meinesgleichen Leuten wie Boos und Konsorten in die Karten spielen, denn der dauerhafte Ausschluss nicht mainstreamkompatibler Besucher war ja gerade ihr Ziel.
Außerdem war die Buchmesse trotz ihrer politisch hyperkorrekten Ausrichtung noch immer so viel mehr als das, was die Kulturfunktionäre des Börsenvereins aus ihr zu machen versuchten. Die Frankfurter Buchmesse ist noch immer ein Forum der Welt, ihrer disparaten Gedanken und all der Versuche, diese Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen. In diese Kerbe schlug übrigens auch Karl Ove Knausgard in seiner Buchmesseneröffnungsrede, als ausführte, wie wunderbar Literatur doch sei, weil sie es uns gestatte, uns in ganz fremde  Existenzen hineinzudenken. Als Beispiel dafür erwähnte er die Einsichten über die Innenbefindlichkeit farbiger Homosexueller, die er dem afroamerikanischen Autor James Baldwin verdanke. Baldwin habe ihn gelehrt, wie es sich anfühlte, als schwuler Schwarzer in den halbrassistischen USA der sechziger Jahre leben zu müssen. Dieses Beispiel imponierte mir, denn es zeigte, wie unabschließbar weit und unbeackert das Feld der Literatur noch ist. Denn wir werden sicher noch lange darauf warten müssen, bis ein renommierter deutscher Verlag einen Roman herausbringt, der in die Innenwelt eines biodeutschen Konservativen beschreibt, der seine Heimat liebt, die Regierung kritisiert und dem die Antifa dafür das Auto abfackelt.
Existenzen hineinzudenken. Als Beispiel dafür erwähnte er die Einsichten über die Innenbefindlichkeit farbiger Homosexueller, die er dem afroamerikanischen Autor James Baldwin verdanke. Baldwin habe ihn gelehrt, wie es sich anfühlte, als schwuler Schwarzer in den halbrassistischen USA der sechziger Jahre leben zu müssen. Dieses Beispiel imponierte mir, denn es zeigte, wie unabschließbar weit und unbeackert das Feld der Literatur noch ist. Denn wir werden sicher noch lange darauf warten müssen, bis ein renommierter deutscher Verlag einen Roman herausbringt, der in die Innenwelt eines biodeutschen Konservativen beschreibt, der seine Heimat liebt, die Regierung kritisiert und dem die Antifa dafür das Auto abfackelt.
Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich meinen Wagen von Bonn nach Frankfurt steuerte. Das Getriebe war im nicht mehr in Ordnung, aber es würde noch eine Weile funktionieren, genau wie unsere alte Bundesrepublik. Aber eines Tages würden beide ihren Geist aufgeben. Ich frage mich nur, wer zuerst, mein Getriebe oder unser Staat? Das war natürlich nur halb ernst gemeint, denn  dem Augenschein nach lief alles glatt, auch wenn ich diesmal wegen meiner unzureichenden Umweltplakette regelrechte Schleichwege fahren musste, um den Rebstockparkplatz zu erreichen. Wie jedes Jahr fuhr ich mit dem Shuttlebus zum Messegelände, erhielt meine Akkreditierung und warf mich in den Ozean der Bücher.
dem Augenschein nach lief alles glatt, auch wenn ich diesmal wegen meiner unzureichenden Umweltplakette regelrechte Schleichwege fahren musste, um den Rebstockparkplatz zu erreichen. Wie jedes Jahr fuhr ich mit dem Shuttlebus zum Messegelände, erhielt meine Akkreditierung und warf mich in den Ozean der Bücher.
Und es war wahrlich wieder ein Ozean, denn etwa 7500 Aussteller präsentierten in über viertausend Veranstaltungen einem nach Hunderttausenden zählenden Publikum (am Ende sollten es 302.000 Besucher gewesen sein) ein literarisches Universum, zu dem zum ersten Mal auch Audio- und Streaming-Inhalte gehörten.
Mein Spaziergang über die Frankfurter Buchmesse begann im Pavillon des diesjährigen Gastlandes Norwegen. Der norwegische Pavillon bestach durch eine kühne (oder war es eine kühle?) Raumkonzeption, der man das monatelange Grübeln über seine optimale Gestaltung anmerkte. Von Büchern war allerdings nicht viel zu sehen, dafür konnte man Norwegen „er-riechen“, d. h. an Gewürzstreuern schnuppern und sich in Gestalt von Ziegenkäse-, Wachs- und Holzduft dem Norden olfaktorisch nähern. Wem das nicht reichte, der durfte sich an „Wittgensteins Boot“ erfreuen, einem halb verfallenen Kahn, in dem Wittgenstein zwar niemals über einen norwegischen Fjord gerudert ist, in dem er aber (Achtung: Wechsel von Indikativ in den Konjunktiv) durchaus hätte rudern können, was unter den ausgeweiteten Wirklichkeitsbegriffen unserer Zeit ja fast das gleiche ist. Wahr ist aber, dass der Philosoph Ludwig Wittgenstein ab  1913 regelmäßig seine Ferien an einem norwegischen Fjord verbrachte, sich ebendort ein kleines Haus erbauen ließ, in dem er sein Spätwerk konzipierte. Soweit zu den Artefakten des norwegischen Pavillons. Was aber war denn nun mit der Literatur? Jeder, der nur ein wenig literaturgeschichtlich bewandert ist, fallen beim Thema Norwegen jede Menge hochklassiger Literaten wie Knausgard, Per Petterson, Erik Foesnes Hansen oder Jo Nesboe ein. Hinter ihnen, oder besser: über allen aber schwebt die monumentale Gestalt Knut Hamsuns, der sich als ein wahrer Elefant im Wohnzimmer der Frankfurter Buchmesse erweisen sollte. Natürlich war ich voreingenommen, denn Knut Hamsun war einer der Leitsterne meiner Jugend gewesen, der Führer durch fremde ebenso wie durch die eine eigene
1913 regelmäßig seine Ferien an einem norwegischen Fjord verbrachte, sich ebendort ein kleines Haus erbauen ließ, in dem er sein Spätwerk konzipierte. Soweit zu den Artefakten des norwegischen Pavillons. Was aber war denn nun mit der Literatur? Jeder, der nur ein wenig literaturgeschichtlich bewandert ist, fallen beim Thema Norwegen jede Menge hochklassiger Literaten wie Knausgard, Per Petterson, Erik Foesnes Hansen oder Jo Nesboe ein. Hinter ihnen, oder besser: über allen aber schwebt die monumentale Gestalt Knut Hamsuns, der sich als ein wahrer Elefant im Wohnzimmer der Frankfurter Buchmesse erweisen sollte. Natürlich war ich voreingenommen, denn Knut Hamsun war einer der Leitsterne meiner Jugend gewesen, der Führer durch fremde ebenso wie durch die eine eigene  Gefühlswelt und der Herr meiner erwachenden Phantasie. Bis auf den heutigen Tag haben August Weltumsegler, der alte Mack, Leutnant Glan, Benoni, Rosa und viele andere ihren festen Platz in meiner literarischen Asservatenkammer. Leider ist Knut Hamsun, den Thomas Mann als „den größten von uns allen“ bezeichnete, heute dem Publikum weitgehend unbekannt. Selbst in Norwegen gibt es keinen Hamsun-Platz, kein Hamsun-Denkmal und keinen Hamsun-Preis. Der vielleicht größte Epiker des 20. Jahrhunderts verschwand wegen seiner Sympathien für den Nationalsozialismus für alle Zeiten in der Nazi-Entrümpelungskiste. Dabei hatte er keinerlei persönliche Schuld auf sich geladen, im Gegenteil, er hatte mehrfach gegen Übergriffe deutscher Besatzungstruppen in Norwegen protestiert, allerdings direkt beim „Führer“ persönlich, dem er nach dessen Tod auch noch einen zutiefst hagiografischen Nachruf schrieb. Das ist irritierend bis auf den heutigen Tag, aber jeder, der nur eine Seite Hamsun gelesen hat, weiß, dass das mit seinem Werk und seinen Figuren rein gar nichts zu tun hat. Und doch wurden seine Bücher nach dem Krieg regelrecht verfemt und aus den Büchereien entfernt. Seine Landsleute konnten ihm seine Sympathie für einen gründlich missverstandenen Nationalsozialismus nicht verzeihen.
Gefühlswelt und der Herr meiner erwachenden Phantasie. Bis auf den heutigen Tag haben August Weltumsegler, der alte Mack, Leutnant Glan, Benoni, Rosa und viele andere ihren festen Platz in meiner literarischen Asservatenkammer. Leider ist Knut Hamsun, den Thomas Mann als „den größten von uns allen“ bezeichnete, heute dem Publikum weitgehend unbekannt. Selbst in Norwegen gibt es keinen Hamsun-Platz, kein Hamsun-Denkmal und keinen Hamsun-Preis. Der vielleicht größte Epiker des 20. Jahrhunderts verschwand wegen seiner Sympathien für den Nationalsozialismus für alle Zeiten in der Nazi-Entrümpelungskiste. Dabei hatte er keinerlei persönliche Schuld auf sich geladen, im Gegenteil, er hatte mehrfach gegen Übergriffe deutscher Besatzungstruppen in Norwegen protestiert, allerdings direkt beim „Führer“ persönlich, dem er nach dessen Tod auch noch einen zutiefst hagiografischen Nachruf schrieb. Das ist irritierend bis auf den heutigen Tag, aber jeder, der nur eine Seite Hamsun gelesen hat, weiß, dass das mit seinem Werk und seinen Figuren rein gar nichts zu tun hat. Und doch wurden seine Bücher nach dem Krieg regelrecht verfemt und aus den Büchereien entfernt. Seine Landsleute konnten ihm seine Sympathie für einen gründlich missverstandenen Nationalsozialismus nicht verzeihen.
Dass es auch ganz anders geht und wie stark im Spannungsfeld von Literatur 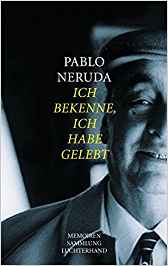 und Politik mit zweierlei Maß gemessen wird, zeigt der direkte Vergleich mit Pablo Neruda, dem vielleicht bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Während man den norwegischen Nobelpreisträger Knut Hamsun wegen seiner Hitlerbewunderung nach dem Zweiten Weltkrieg in ein Irrenhaus steckte, wurde über Nerudas Stalin-Verherrlichung der gnädige Schleier des Vergessens gelegt. Dabei hat auch Neruda nach Stalins Tod dem neben Hitler und Mao größten Menschenschlächter der Weltgeschichte ganze Elogen ins Grab hinterhergeschrieben.
und Politik mit zweierlei Maß gemessen wird, zeigt der direkte Vergleich mit Pablo Neruda, dem vielleicht bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Während man den norwegischen Nobelpreisträger Knut Hamsun wegen seiner Hitlerbewunderung nach dem Zweiten Weltkrieg in ein Irrenhaus steckte, wurde über Nerudas Stalin-Verherrlichung der gnädige Schleier des Vergessens gelegt. Dabei hat auch Neruda nach Stalins Tod dem neben Hitler und Mao größten Menschenschlächter der Weltgeschichte ganze Elogen ins Grab hinterhergeschrieben.
Quod licet jovi non licet bovi, greift hier zu kurz. An der Ungleichbehandlung von Hamsun und Neruda, zwei politisch irregeleiteten literarischen Jahrhundertgestalten erkennt man den vollkommenen Sieg der Linken im Literaturbetrieb der Gegenwart. Diese literaturpolitische Hegemonie der Linken wird Tag für Tag zelebriert,  perpetuiert, und wehe, ein Gremium wagt es, einen falschen, nichtlinken oder gar konservativen Autor auszuzeichnen. Auch dafür bot der aktuelle Literaturbetrieb hinreichendes Anschauungsmaterial. Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse hatte der junge bosnienstämmige Autor Saša Stanišić den deutschen Buchpreis erhalten, fast gleichzeitig wurde dem österreichischen Autor Peter Handke der Literaturnobelpreis verliehen. Während die Auszeichnung des deutsch-bosnischen Autors mit dem deutschen Buchpreis allgemein bejubelt wurde, ging ein Aufschrei der Empörung über Handkes Nobelpreis durch die Gazetten. Denn auch Handke hatte während der Jugoslawienkriege politisch mit den „Falschen“ sympathisiert und sogar den serbischen Präsidenten Milosevic getroffen. Saša
perpetuiert, und wehe, ein Gremium wagt es, einen falschen, nichtlinken oder gar konservativen Autor auszuzeichnen. Auch dafür bot der aktuelle Literaturbetrieb hinreichendes Anschauungsmaterial. Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse hatte der junge bosnienstämmige Autor Saša Stanišić den deutschen Buchpreis erhalten, fast gleichzeitig wurde dem österreichischen Autor Peter Handke der Literaturnobelpreis verliehen. Während die Auszeichnung des deutsch-bosnischen Autors mit dem deutschen Buchpreis allgemein bejubelt wurde, ging ein Aufschrei der Empörung über Handkes Nobelpreis durch die Gazetten. Denn auch Handke hatte während der Jugoslawienkriege politisch mit den „Falschen“ sympathisiert und sogar den serbischen Präsidenten Milosevic getroffen. Saša  Stanišić selbst war sich nicht zu schade, als junger deutscher Buchpreisträger den älteren Kollegen herabzusetzen und das Nobelpreiskomittee zu beschimpfen. Wieder die gleiche unkultivierte Gleichsetzung von Literatur und Leben wie bei Hamsun (nicht aber bei Neruda), als würden Handkes Werke wie „Das Jahr in der Niemandsbucht“ oder „Die linkshändige Frau“ nur durch seinen Milosevic-Besuch zu literarischem Müll.
Stanišić selbst war sich nicht zu schade, als junger deutscher Buchpreisträger den älteren Kollegen herabzusetzen und das Nobelpreiskomittee zu beschimpfen. Wieder die gleiche unkultivierte Gleichsetzung von Literatur und Leben wie bei Hamsun (nicht aber bei Neruda), als würden Handkes Werke wie „Das Jahr in der Niemandsbucht“ oder „Die linkshändige Frau“ nur durch seinen Milosevic-Besuch zu literarischem Müll.
Wie sollte man diese Spannungen bewerten, die wie ein Schatten über der Buchmesse lagen? Als Zeichen der Vitalität, weil sich an ihnen Streit entzündete? Oder als Verfallserscheinungen, weil die intolerante, engstirnige Seite ganz eindeutig die Übermacht besaß? Auf jeden Fall war die Buchmesse politisiert wie lange nicht mehr, so politisiert, dass bei fast allen Veranstaltungen die richtige politische Haltung wie ein ceterum censeo zum Ausdruck gebracht wurde. Es  war, als läge ein imaginärer Gutmenschenduft wie Blütenstaub über den Ständen, als schwebte er durch die Hallen, um sich an bestimmten Ständen wie dem der Frankfurter Rundschau zu pulken, deren Betreiber es sich zur Ehre anrechneten, ihre eigenen Scheuklappen besonders offensiv zur Schau zu stellen.
war, als läge ein imaginärer Gutmenschenduft wie Blütenstaub über den Ständen, als schwebte er durch die Hallen, um sich an bestimmten Ständen wie dem der Frankfurter Rundschau zu pulken, deren Betreiber es sich zur Ehre anrechneten, ihre eigenen Scheuklappen besonders offensiv zur Schau zu stellen.
Ein regelrechter Menschenpulk hatte sich vor dem SPIEGEL-Stand gebildet, wo gerade das Buch „Vom Ende der Klimakrise“ vorgestellt wurde. Die Autoren, die von der Spiegel-Redakteurin Annette Beruhns interviewt wurden, waren Luisa Neubauer, eine der jugendlichen Frontfrauen der „Friday for Future“-Bewegung, und Alexander Repenning, der aussah wie eine studentische Hilfskraft, aber von der Moderatorin als „politischer Ökonom“ vorgestellt wurde. Luisa Neubauer,  eine 23 jährige junge Frau war von berückendem Liebreiz und sah aus wie sich jedes Kind seine Grundschullehrerin vorstellt Aber diese „Lehrerin“ entpuppte sich als eine moderne Kassandra, denn sie hatte keine guten Nachrichten im Petto. Ganz egal, was die Spiegel-Moderatorin fragte, Susanne Neubauer wiederholte in immer neuen Wendungen die Mär vom nahenden Ende der Welt. Es sei fünf vor zwölf, die Lage des Planeten sei desolat, und es bestünde kaum noch Hoffnung auf Rettung. Und wie deprimierend sei der Anblick der „Anzugträger“, die ihr auf den Klimakonferenzen von Stockholm und Katowice begegnet waren und die noch immer nicht den Ernst der Lage begriffen hatten. Geradezu erschüttert war Frau Neubauer über Annegret Kramp -Karrenbauer, die nach ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden alles Mögliche versprochen, aber das Hauptproblem der Menschheit, den Klimawandel, überhaupt nicht erwähnt hatte. Ja, wie ist denn so etwas möglich, fragte Frau Neubauer kopfschüttelnd und blickte in die Gesichter
eine 23 jährige junge Frau war von berückendem Liebreiz und sah aus wie sich jedes Kind seine Grundschullehrerin vorstellt Aber diese „Lehrerin“ entpuppte sich als eine moderne Kassandra, denn sie hatte keine guten Nachrichten im Petto. Ganz egal, was die Spiegel-Moderatorin fragte, Susanne Neubauer wiederholte in immer neuen Wendungen die Mär vom nahenden Ende der Welt. Es sei fünf vor zwölf, die Lage des Planeten sei desolat, und es bestünde kaum noch Hoffnung auf Rettung. Und wie deprimierend sei der Anblick der „Anzugträger“, die ihr auf den Klimakonferenzen von Stockholm und Katowice begegnet waren und die noch immer nicht den Ernst der Lage begriffen hatten. Geradezu erschüttert war Frau Neubauer über Annegret Kramp -Karrenbauer, die nach ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden alles Mögliche versprochen, aber das Hauptproblem der Menschheit, den Klimawandel, überhaupt nicht erwähnt hatte. Ja, wie ist denn so etwas möglich, fragte Frau Neubauer kopfschüttelnd und blickte in die Gesichter  ihrer Zuhörer, die sich das auch nicht erklären konnten. Wie dramatisch die Lage war, erklärte Frau Neubauer anschließend anhand der Saga von der Pazifikinsel Nauru. Die Südseeinsel Nauru, einer der kleinsten Staaten der Welt, war in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts durch die Ausbeutung reichhaltiger Phosphatfelder kurzfristig sehr reich geworden, zeitweilig soll der Inselstaat über das höchste Pro Kopf-Einkommen der Welt verfügt haben. Als die Phosphatfelder jedoch erschöpft waren, stürzte die Insel in Armut und Not. Die Details, die Frau Neubauer dazu schilderte, waren wahrlich bemerkenswert, auch wenn sie eins zu eins aus dem SPIEGEL-Artikel übernommen worden waren, der am 5.11.2011 erscheinen war. Damals war Frau Neubauer fünfzehn Jahre alt gewesen, vielleicht hatte einer ihrer Sozialkunde-Lehrer, der sicher auch den SPIEGEL las, sie mit diesem Bericht konfrontiert und die Glut der Ergriffenheit in ihr Herz gelegt, die sie bis heute befeuerte? Mich erinnerte die Geschichte von der Südseeinsel Nauru dagegen ein wenig an die Mär vom Südseehäuptling Papalagi, wenngleich im zeitgemäß-dystopischen Dressing. Aber selbst wenn die Geschichte stimmen sollte, fragte ich mich, was sie mit dem Klimawandel zu tun hatte. Erstaunlicherweise schien das Niemandem aufzufallen, denn entsprechende Nachfragen blieben aus. Stattdessen entdeckte ich die eine oder andere Zornesfalte auf den glatten Stirnen der meist jugendlichen Zuhörer, die wie gewünscht von der Südseeinsel Nauru auf den Planeten schlossen und einen weiteren Beleg dafür einsacken konnten, wie düster die Zukunft aussah. Alexander Repenning, der bislang den Ausführungen von Luisa Neubauer freundlich nickend gefolgt war, kam auf instrumentelle Fragen der Mobilisierung der Klimabewegung zu sprechen. Er zitierte einen amerikanischen Forscher, der die „magische Zahl von 3,5 %“ entdeckt habe, was für die „Friday for Future“ Bewegung sehr wichtig sei, denn immer dann, wenn sich 3,5 % der
ihrer Zuhörer, die sich das auch nicht erklären konnten. Wie dramatisch die Lage war, erklärte Frau Neubauer anschließend anhand der Saga von der Pazifikinsel Nauru. Die Südseeinsel Nauru, einer der kleinsten Staaten der Welt, war in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts durch die Ausbeutung reichhaltiger Phosphatfelder kurzfristig sehr reich geworden, zeitweilig soll der Inselstaat über das höchste Pro Kopf-Einkommen der Welt verfügt haben. Als die Phosphatfelder jedoch erschöpft waren, stürzte die Insel in Armut und Not. Die Details, die Frau Neubauer dazu schilderte, waren wahrlich bemerkenswert, auch wenn sie eins zu eins aus dem SPIEGEL-Artikel übernommen worden waren, der am 5.11.2011 erscheinen war. Damals war Frau Neubauer fünfzehn Jahre alt gewesen, vielleicht hatte einer ihrer Sozialkunde-Lehrer, der sicher auch den SPIEGEL las, sie mit diesem Bericht konfrontiert und die Glut der Ergriffenheit in ihr Herz gelegt, die sie bis heute befeuerte? Mich erinnerte die Geschichte von der Südseeinsel Nauru dagegen ein wenig an die Mär vom Südseehäuptling Papalagi, wenngleich im zeitgemäß-dystopischen Dressing. Aber selbst wenn die Geschichte stimmen sollte, fragte ich mich, was sie mit dem Klimawandel zu tun hatte. Erstaunlicherweise schien das Niemandem aufzufallen, denn entsprechende Nachfragen blieben aus. Stattdessen entdeckte ich die eine oder andere Zornesfalte auf den glatten Stirnen der meist jugendlichen Zuhörer, die wie gewünscht von der Südseeinsel Nauru auf den Planeten schlossen und einen weiteren Beleg dafür einsacken konnten, wie düster die Zukunft aussah. Alexander Repenning, der bislang den Ausführungen von Luisa Neubauer freundlich nickend gefolgt war, kam auf instrumentelle Fragen der Mobilisierung der Klimabewegung zu sprechen. Er zitierte einen amerikanischen Forscher, der die „magische Zahl von 3,5 %“ entdeckt habe, was für die „Friday for Future“ Bewegung sehr wichtig sei, denn immer dann, wenn sich 3,5 % der  Bevölkerung an öffentlichen Demonstrationen beteiligten, haben sie über kurz oder lang Erfolg. Insofern befinde man sich auf einem guten Weg, denn bei der letzten öffentlichen „Friday for Future“ Demonstration in ganz Deutschland habe man bereits 1,5 % der Bevölkerung auf die Straßen gebracht. Nun kam die Moderatorin wieder auf das Buch zu sprechen, das ja immerhin den Titel „Vom Ende der Klimakrise“ trug und fragte, wie denn der drohende Untergang der Welt konkret abgewendet werden könne. Frau Neubauer antwortete, dass alles darauf ankäme, die Lebensweise zu ändern. Eine fundamentale Neugestaltung des Alltagsverhaltens sei erforderlich, wenn der Planet gerettet werden sollte. Frau Neubauer entwickelte die Vision eines erleuchteten deutsches Volkes von lauter Mülltrennern, Plastikvermeidern, Veganern und Fahrradfahrern, die in ihre Gesamtheit den CO2 Ausstoß senken würden – auch wenn der Anteil Deutschlands am weltweiten CO2 Austoß gerade mal 2,3 % betrug.
Bevölkerung an öffentlichen Demonstrationen beteiligten, haben sie über kurz oder lang Erfolg. Insofern befinde man sich auf einem guten Weg, denn bei der letzten öffentlichen „Friday for Future“ Demonstration in ganz Deutschland habe man bereits 1,5 % der Bevölkerung auf die Straßen gebracht. Nun kam die Moderatorin wieder auf das Buch zu sprechen, das ja immerhin den Titel „Vom Ende der Klimakrise“ trug und fragte, wie denn der drohende Untergang der Welt konkret abgewendet werden könne. Frau Neubauer antwortete, dass alles darauf ankäme, die Lebensweise zu ändern. Eine fundamentale Neugestaltung des Alltagsverhaltens sei erforderlich, wenn der Planet gerettet werden sollte. Frau Neubauer entwickelte die Vision eines erleuchteten deutsches Volkes von lauter Mülltrennern, Plastikvermeidern, Veganern und Fahrradfahrern, die in ihre Gesamtheit den CO2 Ausstoß senken würden – auch wenn der Anteil Deutschlands am weltweiten CO2 Austoß gerade mal 2,3 % betrug.
Fast war ich enttäuscht, dass meine schon recht bescheidenen Erwartungen noch unterboten wurden. Bei den Zuhörern war von Enttäuschung allerdings nichts zu spüren. Ihre Augen leuchteten, wenn Neubauer und Repenning sprachen, sie  klatschten enthusiastisch und waren wahrscheinlich umso begeisterterer, je weniger sie von Sonnenprotuberanzen, Klimageschichte oder Milanković-Zyklen wussten. Eine tiefe Hoffnungslosigkeit überfiel mich beim Anblick der spiegelblanken, weichen, sympathischen Gesichter, in deren Zügen ich das Gute in Gestalt der kompletten Ahnungslosigkeit erblickte. Aber es war ja nicht nur die Ahnungslosigkeit der Jugend, die beunruhigen musste – bis tief in das sogenannten akademische, insbesondere das geisteswissenschaftliche Milieu hinein war der Klimaglaube mittlerweile vorgedrungen. Seit meinen turbulenten Diskussionen mit rotgrünen Lesefreunden wusste ich, dass der Bereich des Klimawandels sich längst aus der Phase des instrumentellen und widerlegbaren Wissens emanzipiert und in den Bereich des „Heils- und Erlösungswissens“ emporgearbeitet hatte. Von Max Scheler, der diese Wissensformen in seiner Wissenschaftstheorie unterscheiden hatte, sprach übrigens auch niemand mehr.
klatschten enthusiastisch und waren wahrscheinlich umso begeisterterer, je weniger sie von Sonnenprotuberanzen, Klimageschichte oder Milanković-Zyklen wussten. Eine tiefe Hoffnungslosigkeit überfiel mich beim Anblick der spiegelblanken, weichen, sympathischen Gesichter, in deren Zügen ich das Gute in Gestalt der kompletten Ahnungslosigkeit erblickte. Aber es war ja nicht nur die Ahnungslosigkeit der Jugend, die beunruhigen musste – bis tief in das sogenannten akademische, insbesondere das geisteswissenschaftliche Milieu hinein war der Klimaglaube mittlerweile vorgedrungen. Seit meinen turbulenten Diskussionen mit rotgrünen Lesefreunden wusste ich, dass der Bereich des Klimawandels sich längst aus der Phase des instrumentellen und widerlegbaren Wissens emanzipiert und in den Bereich des „Heils- und Erlösungswissens“ emporgearbeitet hatte. Von Max Scheler, der diese Wissensformen in seiner Wissenschaftstheorie unterscheiden hatte, sprach übrigens auch niemand mehr.
Wie es der Zufall wollte, stieß ich am LITCAM Stand auf das Buch „Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?“ von Jürgen Kaube. Nach dem, was ich gerade bei Luisa Neubauer und Alexander Repenning erlebt hatte, erschien mir das geradezu unmöglich, aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Jürgen Kaube, der immerhin FAZ Herausgeber war, saß ein wenig eingesackt in seinem Sessel, trug einen blauen, ausgeleierten Anzug, dazu bordeauxrote Socken und  braune Halbschuhe. Seine krausen Haare hingen ihm wirr in die Stirn, und auch der Bart hätte ein Drei-Tage-Styling gut vertragen können. Die Moderatorin war eine sehr appetitliche Dame ganz in Rot, deren Interviewtechnik im Wesentlichen darin bestand, kaum etwas zu sagen oder zu fragen, so dass Jürgen Kaube ohne Führung und Struktur vom Hölzchen aufs Stöckchen kam. Er begann mit seinem schulischen Werdegang auf einem reinen Jungen-Gymnasium, auf dem im Deutschunterricht fast nur Texte gelesen worden waren, die von „leidenden Frauen“ handelten. Aus der Erinnerung heraus, wie wenig er als junger Mensch mit den „leidenden Frauen“ habe anfangen können, war Herrn Kaube die erste fundamentale bildungspolitische Einsicht zugewachsen: Dem Schüler muss die Relevanz von Literatur nahe gebracht werden, mit anderen Worten: er soll sich fragen „Kann ich mit dem Faust etwas anfangen?“ Herr Kaube erläuterte, wie egal es deswegen
braune Halbschuhe. Seine krausen Haare hingen ihm wirr in die Stirn, und auch der Bart hätte ein Drei-Tage-Styling gut vertragen können. Die Moderatorin war eine sehr appetitliche Dame ganz in Rot, deren Interviewtechnik im Wesentlichen darin bestand, kaum etwas zu sagen oder zu fragen, so dass Jürgen Kaube ohne Führung und Struktur vom Hölzchen aufs Stöckchen kam. Er begann mit seinem schulischen Werdegang auf einem reinen Jungen-Gymnasium, auf dem im Deutschunterricht fast nur Texte gelesen worden waren, die von „leidenden Frauen“ handelten. Aus der Erinnerung heraus, wie wenig er als junger Mensch mit den „leidenden Frauen“ habe anfangen können, war Herrn Kaube die erste fundamentale bildungspolitische Einsicht zugewachsen: Dem Schüler muss die Relevanz von Literatur nahe gebracht werden, mit anderen Worten: er soll sich fragen „Kann ich mit dem Faust etwas anfangen?“ Herr Kaube erläuterte, wie egal es deswegen  für den Schüler sei, ob sich die Romantik vor, während oder nach der Klassik ereignet habe. Deswegen hielt er auch nichts von Kurzzusammenfassungen wie Sommers „Weltliteratur to go“, in dem die hundert bedeutendsten Werke der Weltliteratur auf das geistige Niveau eines Marvel-Comics heruntergebrochen wurden. Das allerdings wunderte mich, denn Michael Sommer, der intelligente und witzige spiritus rector dieser Reihe, hatte klar doch ganz klar formuliert, worin der wesentliche Ertrag von Literaturkenntnissen bestände: Man könne damit auf Partys prächtig angeben. Jürgen Kaube aber hatte anderes im Sinn, was genau, wurde allerdings nicht recht deutlich, denn er verlor im Angesicht der eisern schweigenden Moderatorin ein wenig die Navigation. Ja, sagte er etwas unvermittelt, Schule sei ein durch und durch „lokales Phänomen“, und deswegen sei die Anbindung der Lehrstoffe an die lokalen Gegebenheiten der Königsweg der Relevanz. „Erdkunde-Unterricht in den Alpen muss doch ganz anders aussehen als Erdkunde-Unterricht an der Nordsee.“ Lokalität besitze außerdem eine enge Affinität zur „schulischen Freiheit“, die man den Schulen in viel größerem Ausmaß gewähren müsse als bisher. An dieser Stelle wurde die Moderatorin plötzlich rege, riss ihre schönen Augen auf und fragte: „Aber wie sichern Sie denn dann die Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse?“ Darauf wusste der Autor keine Antwort, außer der Behauptung, es sei ohnehin weitgehend egal, was in den Schulen konkret gelehrt werde, denn die schulischen Inhalte hätten mit dem späteren Studienstoff kaum etwas zu tun.
für den Schüler sei, ob sich die Romantik vor, während oder nach der Klassik ereignet habe. Deswegen hielt er auch nichts von Kurzzusammenfassungen wie Sommers „Weltliteratur to go“, in dem die hundert bedeutendsten Werke der Weltliteratur auf das geistige Niveau eines Marvel-Comics heruntergebrochen wurden. Das allerdings wunderte mich, denn Michael Sommer, der intelligente und witzige spiritus rector dieser Reihe, hatte klar doch ganz klar formuliert, worin der wesentliche Ertrag von Literaturkenntnissen bestände: Man könne damit auf Partys prächtig angeben. Jürgen Kaube aber hatte anderes im Sinn, was genau, wurde allerdings nicht recht deutlich, denn er verlor im Angesicht der eisern schweigenden Moderatorin ein wenig die Navigation. Ja, sagte er etwas unvermittelt, Schule sei ein durch und durch „lokales Phänomen“, und deswegen sei die Anbindung der Lehrstoffe an die lokalen Gegebenheiten der Königsweg der Relevanz. „Erdkunde-Unterricht in den Alpen muss doch ganz anders aussehen als Erdkunde-Unterricht an der Nordsee.“ Lokalität besitze außerdem eine enge Affinität zur „schulischen Freiheit“, die man den Schulen in viel größerem Ausmaß gewähren müsse als bisher. An dieser Stelle wurde die Moderatorin plötzlich rege, riss ihre schönen Augen auf und fragte: „Aber wie sichern Sie denn dann die Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse?“ Darauf wusste der Autor keine Antwort, außer der Behauptung, es sei ohnehin weitgehend egal, was in den Schulen konkret gelehrt werde, denn die schulischen Inhalte hätten mit dem späteren Studienstoff kaum etwas zu tun.
An dieser Stelle reichte es mir, und ich verließ meinen Sitz in der zweiten Reihe. Wieder hatte ich nichts zum eigentlichen Thema der Buchvorstellung erfahren. Weder hatte mir Luisa Neubauer klarmachen können, wie die Klimakrise zu bewältigen sei, noch hatte Jürgen Kaube Überzeugendes ausgeführt, wie man die  Verblödung durch Schule verhindern könnte – mehr noch: bei Kaube hatte ich sogar den Verdacht, dass seine Vorschläge die allgemeine Verblödung noch verstärken würden. Alles war nebulös. Wie der Blütenstaub des Gutmenschentums schwebte auch das Neubulöse wie eine unsichtbare Wolke über den Veranstaltungen dieser Buchmesse.
Verblödung durch Schule verhindern könnte – mehr noch: bei Kaube hatte ich sogar den Verdacht, dass seine Vorschläge die allgemeine Verblödung noch verstärken würden. Alles war nebulös. Wie der Blütenstaub des Gutmenschentums schwebte auch das Neubulöse wie eine unsichtbare Wolke über den Veranstaltungen dieser Buchmesse.
Hinter der nächsten Ecke saß die junge deutsche Autorin Julia Bossong auf dem „blauen Sofa“ und wurde zu ihrem neuen Roman „Schutzzone“ interviewt. Schutzzone, so entnahm ich den ausliegenden Informationen, handelt von einer UN-Angestellten, die sich in Afrika um Flüchtlinge und Notleidende kümmert und dabei eine Jugendbekanntschaft wiedertrifft. Die Bewertungen bei Amazon  waren, wie ich später herausfinden sollte, katastrophal. 43 % der Rezensenten hatten der Autorin für ihr Buch nur einen oder zwei Sterne gegeben. Nur unser Außenminister hatte mit seinem Grundlagenwerk „Aufstehen gegen Rechts“ noch schlechtere Bewertungen eingefahren und war von 92 % der Rezensenten mit nur einem Punkt versehen worden (Da sage noch einer, mit der politischen Urteilskraft der Deutschen sei es nicht weit her). Wie gut oder wie schlecht das Buch von Julia Bossong wirklich war, konnte ich natürlich nicht beurteilen, weil ich die Lesung verpasst hatte und sich das Nachgespräch schon seinem Ende näherte. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass am Ende von Buchmessen-Interviews oft die blödesten Fragen kommen, und so war es auch heute. „Welche Hilfe für die Reform der UN kann die Literatur leisten?“ fragte die Moderatorin, und Nora Bossong antwortete erwartungsgemäß, dass es in der Literatur darum gehen müsse, „neue positive Narrative zugunsten der EU und der UN“ zu entwickeln. Die naheliegende Frage, ob diese klare Arbeitsanweisung nicht ein wenig an eine Kulturpolitik a la Shdanow erinnerte, blieb aus. Die Autorin setzt stattdessen in freier Improvisation noch einen drauf und kam unvermittelt auf die Disproportionalität der Zusammensetzung des UN Sicherheitsrates zu sprechen, dessen fünf ständige Mitglieder alle aus dem Norden kämen. „Allein zwei aus Europa“, fügte sie hinzu. Tatsächlich waren es inklusive Russlands sogar drei, aber wer wollte hier auf Kleinigkeiten pochen, wenn es um weltumspannende Fragen ging?
waren, wie ich später herausfinden sollte, katastrophal. 43 % der Rezensenten hatten der Autorin für ihr Buch nur einen oder zwei Sterne gegeben. Nur unser Außenminister hatte mit seinem Grundlagenwerk „Aufstehen gegen Rechts“ noch schlechtere Bewertungen eingefahren und war von 92 % der Rezensenten mit nur einem Punkt versehen worden (Da sage noch einer, mit der politischen Urteilskraft der Deutschen sei es nicht weit her). Wie gut oder wie schlecht das Buch von Julia Bossong wirklich war, konnte ich natürlich nicht beurteilen, weil ich die Lesung verpasst hatte und sich das Nachgespräch schon seinem Ende näherte. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass am Ende von Buchmessen-Interviews oft die blödesten Fragen kommen, und so war es auch heute. „Welche Hilfe für die Reform der UN kann die Literatur leisten?“ fragte die Moderatorin, und Nora Bossong antwortete erwartungsgemäß, dass es in der Literatur darum gehen müsse, „neue positive Narrative zugunsten der EU und der UN“ zu entwickeln. Die naheliegende Frage, ob diese klare Arbeitsanweisung nicht ein wenig an eine Kulturpolitik a la Shdanow erinnerte, blieb aus. Die Autorin setzt stattdessen in freier Improvisation noch einen drauf und kam unvermittelt auf die Disproportionalität der Zusammensetzung des UN Sicherheitsrates zu sprechen, dessen fünf ständige Mitglieder alle aus dem Norden kämen. „Allein zwei aus Europa“, fügte sie hinzu. Tatsächlich waren es inklusive Russlands sogar drei, aber wer wollte hier auf Kleinigkeiten pochen, wenn es um weltumspannende Fragen ging?
Am Stand der Süddeutschen Zeitung wurde der Spiegel-Reporter Juan Moreno interviewt, der einen der größten Journalismus-Skandale der letzten Jahre aufgedeckt hatte. Der Zuschauerandrang war enorm, und nur mit Mühe konnte ich einen Blick auf die Hauptperson erhaschen. Juan Moreno sah viel besser aus  als auf den Bildern, die von ihm publiziert worden waren: mit frischer Gesichtsfarbe, brauner Lederjacke und kessem Schal um den Hals saß er locker in seinem Sessel und stellte sein Buch „Tausend Zeilen Lügen“ vor, in dem die Geschichte der Relotius-Enttarnung erzählt wurde. Claas Relotius, ein gewiefter Baron Münchhausen im warmen Whirlpool einer multikulturell verpeilten Qualitätspresse hatte der weithin gerühmten superkritischen Rechercheabteilung des Spiegel einen Bären nach dem anderen aufgebunden und lauter Märchengeschichten veröffentlicht, für die er mit Journalistenpreisen überhäuft worden war. Er hatte (vermeintlich) mit Häftlingen in amerikanische Gefängnissen geduscht, einen Flüchtlingsjungen, der von „Mama Merkel“ träumte, portraitiert und einen anderen ausfindig gemacht, wegen dem der Syrienkrieg ausgebrochen war. Aufgeflogen war er, als er einen Artikel über einen Ort voller Rednecks in Arizona veröffentlichte, ohne jemals dort gewesen zu sein. Dieser Artikel hatte Juan Morenos Verdacht geweckt, der zu weiteren Recherchen führte, an deren Ende die Entlarvung des Schwindlers stand.
als auf den Bildern, die von ihm publiziert worden waren: mit frischer Gesichtsfarbe, brauner Lederjacke und kessem Schal um den Hals saß er locker in seinem Sessel und stellte sein Buch „Tausend Zeilen Lügen“ vor, in dem die Geschichte der Relotius-Enttarnung erzählt wurde. Claas Relotius, ein gewiefter Baron Münchhausen im warmen Whirlpool einer multikulturell verpeilten Qualitätspresse hatte der weithin gerühmten superkritischen Rechercheabteilung des Spiegel einen Bären nach dem anderen aufgebunden und lauter Märchengeschichten veröffentlicht, für die er mit Journalistenpreisen überhäuft worden war. Er hatte (vermeintlich) mit Häftlingen in amerikanische Gefängnissen geduscht, einen Flüchtlingsjungen, der von „Mama Merkel“ träumte, portraitiert und einen anderen ausfindig gemacht, wegen dem der Syrienkrieg ausgebrochen war. Aufgeflogen war er, als er einen Artikel über einen Ort voller Rednecks in Arizona veröffentlichte, ohne jemals dort gewesen zu sein. Dieser Artikel hatte Juan Morenos Verdacht geweckt, der zu weiteren Recherchen führte, an deren Ende die Entlarvung des Schwindlers stand.
 Juan Morenos Buch „Tausend Zeilen Lügen“ begann mit einer regelrechten High Noon-Szene am 3. 12. 2018, jenem Tag, an dem Claas Relotius wieder einmal einen Journalismuspreis entgegen nahm, dabei aber schon von einer Mail aus Arizona wusste, die seine Fakes aufliegen lassen würde. Mit Nerven wie Drahtseile hatte Relotius trotzdem unverdrossen in die Kameras gelächelt, hatte in dem einem oder anderen Gespräch sogar Mitleid mit Juan Moreno erkennen lassen, der damals wegen seiner Recherchen gegen den SPIEGEL Starreporter Relotius kurz vor dem Rausschmiss stand. Auch wenn Moreno als loyaler SPIEGEL Angestellter diesen Aspekt so gut es ging herunterspielte, bestand in dieser Recherche-Behinderung durch den SPIEGEL der zweite Skandal. Denn die Wahrheit war, dass die Lügengeschichten von Claas Relotius der SPIEGEL Redaktion hochwillkommen waren, weil sie sich bestens dazu eigneten, das multikulturelle Mainstream-Eiapoppeia mit unterhaltsamen Reportagen zu unterfüttern. Ob er denn wegen seiner Verdienste inzwischen eine Festanstellung beim SPIEGEL erhalten habe, fragte der Moderator. Nein, antwortete Moreno, eine Festanstellung sei ihm nicht angeboten worden. Das war bitter für den aufrechten Reporter, der wahrscheinlich längst wusste, dass er mit seiner Enthüllungsgeschichte langfristig nicht reüssieren würde. Moreno hatte den SPIEGEL als Tendenzblatt enttarnt, und es auch wenn es aktuell von der Seite der SPIEGEL Redaktion unvermeidbar war, das tapferere Schneiderlein aus dem Umfeld der eigenen Fußtruppen öffentlich zu loben, tat man es doch mit der Faust in der Tasche.
Juan Morenos Buch „Tausend Zeilen Lügen“ begann mit einer regelrechten High Noon-Szene am 3. 12. 2018, jenem Tag, an dem Claas Relotius wieder einmal einen Journalismuspreis entgegen nahm, dabei aber schon von einer Mail aus Arizona wusste, die seine Fakes aufliegen lassen würde. Mit Nerven wie Drahtseile hatte Relotius trotzdem unverdrossen in die Kameras gelächelt, hatte in dem einem oder anderen Gespräch sogar Mitleid mit Juan Moreno erkennen lassen, der damals wegen seiner Recherchen gegen den SPIEGEL Starreporter Relotius kurz vor dem Rausschmiss stand. Auch wenn Moreno als loyaler SPIEGEL Angestellter diesen Aspekt so gut es ging herunterspielte, bestand in dieser Recherche-Behinderung durch den SPIEGEL der zweite Skandal. Denn die Wahrheit war, dass die Lügengeschichten von Claas Relotius der SPIEGEL Redaktion hochwillkommen waren, weil sie sich bestens dazu eigneten, das multikulturelle Mainstream-Eiapoppeia mit unterhaltsamen Reportagen zu unterfüttern. Ob er denn wegen seiner Verdienste inzwischen eine Festanstellung beim SPIEGEL erhalten habe, fragte der Moderator. Nein, antwortete Moreno, eine Festanstellung sei ihm nicht angeboten worden. Das war bitter für den aufrechten Reporter, der wahrscheinlich längst wusste, dass er mit seiner Enthüllungsgeschichte langfristig nicht reüssieren würde. Moreno hatte den SPIEGEL als Tendenzblatt enttarnt, und es auch wenn es aktuell von der Seite der SPIEGEL Redaktion unvermeidbar war, das tapferere Schneiderlein aus dem Umfeld der eigenen Fußtruppen öffentlich zu loben, tat man es doch mit der Faust in der Tasche.
Buchmessen besuchen macht müde, das hatte ich schon in den letzten Jahren  erlebt. Außerdem war die Luft schlecht, zu viel Papier, zu viel CO2 in den Hallen. Ich war schon auf dem Weg an die frische Luft, als ich am Stand des „Westend Verlages“ auf eine hektisch diskutiere Runde traf. Endlich einmal Dissens dachte ich und setzte mich auf den letzten freien Hocker. An diesem Tag ging es um Erwin Thomas Buch „Was der Mensch von der Natur lernen kann“ und Franz Alts neuestes Werk „Die Alternative. Plädoyer für eine sonnige Zukunft“. Erwin Thoma verkörperte einen Öko-Aktivisten der besten Sorte, d.h. jemanden, der seine Weltanschauung auch lebte, denn er hatte seinen Kindern, als sie in den städtischen Betonhäusern krank wurden, ein Holzhaus gebaut, und zwar ein Mondholzhaus. Unter Mondholz, so der Autor, versteht man ein Holz, das in der Weihnachtszeit bei abnehmendem Mond geschlagen wird. Derartiges Holz sei besonders trocken, rissfrei, verbindungsstabil und auch noch unempfindlicher gegen Fäulnis und Insektenbefall, so dass ökobewusse Kunden für Mondholz gerne einen höheren Preis bezahlen. Erwin Thoma war groß, schlank und knorrig und blieb mit seinen Beiträgen konkret bis an die Grenze zur Unverständlichkeit, was ich aber nicht dem Autor, sondern mir anlasten möchte, denn als verkümmerter Spross der urbanen Zivilisation habe ich leider von Holz überhaupt keine Ahnung.
erlebt. Außerdem war die Luft schlecht, zu viel Papier, zu viel CO2 in den Hallen. Ich war schon auf dem Weg an die frische Luft, als ich am Stand des „Westend Verlages“ auf eine hektisch diskutiere Runde traf. Endlich einmal Dissens dachte ich und setzte mich auf den letzten freien Hocker. An diesem Tag ging es um Erwin Thomas Buch „Was der Mensch von der Natur lernen kann“ und Franz Alts neuestes Werk „Die Alternative. Plädoyer für eine sonnige Zukunft“. Erwin Thoma verkörperte einen Öko-Aktivisten der besten Sorte, d.h. jemanden, der seine Weltanschauung auch lebte, denn er hatte seinen Kindern, als sie in den städtischen Betonhäusern krank wurden, ein Holzhaus gebaut, und zwar ein Mondholzhaus. Unter Mondholz, so der Autor, versteht man ein Holz, das in der Weihnachtszeit bei abnehmendem Mond geschlagen wird. Derartiges Holz sei besonders trocken, rissfrei, verbindungsstabil und auch noch unempfindlicher gegen Fäulnis und Insektenbefall, so dass ökobewusse Kunden für Mondholz gerne einen höheren Preis bezahlen. Erwin Thoma war groß, schlank und knorrig und blieb mit seinen Beiträgen konkret bis an die Grenze zur Unverständlichkeit, was ich aber nicht dem Autor, sondern mir anlasten möchte, denn als verkümmerter Spross der urbanen Zivilisation habe ich leider von Holz überhaupt keine Ahnung.
 Erwin Thomas Gesprächspartner war Franz Alt, der wie ein alter Indianerhäuptling der Runde präsidierte und von den fantastischen Aussichten der Sonnenenergie schwärmte. Sein Vortrag war durchsetzt mit Wendungen wie „als ich kürzlich mit dem König von Marokko ein Solarzellenfeld einweihte“ oder „vor kurzem war ich mit dem Energieminister von Mali unterwegs“ und kulminierte in der These, dass der energische Ausbau der Sonnenenergie Afrika retten würde. Wenn man in Afrika nur kräftig die Sonnenenergie ausbauen würde, hätten die Menschen Arbeit und Brot und keinen Grund mehr, ihr Heil in einer Massenflucht nach Norden zu suchen. Demgegenüber hatte der Moderator einen schweren Stand. Er fragte zwar immer wieder nach den ungelösten Problemen der Sonnenenergiespeicherung und –leitung, was Franz Alt lässig mit dem Satz vom Tisch quittierte „Die Sonne scheint überall.“
Erwin Thomas Gesprächspartner war Franz Alt, der wie ein alter Indianerhäuptling der Runde präsidierte und von den fantastischen Aussichten der Sonnenenergie schwärmte. Sein Vortrag war durchsetzt mit Wendungen wie „als ich kürzlich mit dem König von Marokko ein Solarzellenfeld einweihte“ oder „vor kurzem war ich mit dem Energieminister von Mali unterwegs“ und kulminierte in der These, dass der energische Ausbau der Sonnenenergie Afrika retten würde. Wenn man in Afrika nur kräftig die Sonnenenergie ausbauen würde, hätten die Menschen Arbeit und Brot und keinen Grund mehr, ihr Heil in einer Massenflucht nach Norden zu suchen. Demgegenüber hatte der Moderator einen schweren Stand. Er fragte zwar immer wieder nach den ungelösten Problemen der Sonnenenergiespeicherung und –leitung, was Franz Alt lässig mit dem Satz vom Tisch quittierte „Die Sonne scheint überall.“
Wie schon erwähnt, war das an diesem Tag in Frankfurt leider nicht der Fall. Tief hingen die Wolken über der Buchmesse, es war windig und kühl, so dass ich in der Halle blieb und mich am Azubi Stand niederließ, wo ich mich mit zwei Tassen starken Kaffees wieder auf Vordermann brachte. Während der Koffein meine Gehirnwindungen revitalisierte, beobachtete ich die vorbeidefilierenden Massen. In den letzten Jahren waren mir die schönen jungen Frauen aufgefallen, die mit keuscher Körpersprache die endlosen Buchreihen entlanggehuscht  waren. Ich hatte mich über die resignierten Gesichter älterer Buchmessen Besucher gewundert, die die Hoffnung wohl aufgegeben hatten, das richtige Buch zu finden. Diesmal waren erstaunlich viele Jugendliche unterwegs, gerade so als sei dieser Buchmessen Freitag ein legitimer Ersatz für die übliche „Friday for Future“ Demonstration. In großen Tragetaschen transportierten sie die Freiexemplare der ZEIT, der FAZ, der Süddeutschen, der Taz oder wie immer die Periodika unserer Mainstreampresse auch heißen mochten, wie kostbare Schätze. Zuhause werden sie alle das gleiche lesen, und wenn sie sich treffen, werden sie sich das gleiche erzählen.
waren. Ich hatte mich über die resignierten Gesichter älterer Buchmessen Besucher gewundert, die die Hoffnung wohl aufgegeben hatten, das richtige Buch zu finden. Diesmal waren erstaunlich viele Jugendliche unterwegs, gerade so als sei dieser Buchmessen Freitag ein legitimer Ersatz für die übliche „Friday for Future“ Demonstration. In großen Tragetaschen transportierten sie die Freiexemplare der ZEIT, der FAZ, der Süddeutschen, der Taz oder wie immer die Periodika unserer Mainstreampresse auch heißen mochten, wie kostbare Schätze. Zuhause werden sie alle das gleiche lesen, und wenn sie sich treffen, werden sie sich das gleiche erzählen.
Das führende Blatt dieser Mainstreampresse ist noch immer die Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT. Für mich ähnelt die ZEIT einem nahen Verwandten, dem ich einmal sehr eng verbunden gewesen war, mit dem ich mich aber überworfen hatte. Ich habe die ZEIT jahrzehntelang gelesen, habe selbst in ihr zahlreiche Artikel zu Reise und Geschichte veröffentlicht und mich erst von ihr abgewandt, als sie sich immer unverhohlener von einer großen liberalen Wochenzeitung zum Zentralorgan des rotgrünen Zeitgeistes wandelte. Trotzdem war der Besuch am Messestand der ZEIT noch immer ein Muss. Auch dieses Mal glänzte die Zeitung mit einem Staraufgebot an berühmten Autoren, wobei ich es  ihr als besonderen Vorzug anrechnen möchte, dass es nicht nur politisierende Ökologen und Linke waren, die zu Wort kamen. An diesem Freitagnachmittag war Jostein Gaarder zu Gast, der weltberühmte Autor des Buches „Sofies Welt“. Jostein Gaarder sah aus wie der hübschere, gutmütigere Bruder des Gollum aus dem „Herrn der Ringe“. Wie dieser trug einer eine schüttere zerzauste Frisur auf seinem kugelrunden Kopf und sah aus wie ein Zwerg, der den Ring der Weisheit besaß und seine Zuhörer gerne daran teilhaben haben
ihr als besonderen Vorzug anrechnen möchte, dass es nicht nur politisierende Ökologen und Linke waren, die zu Wort kamen. An diesem Freitagnachmittag war Jostein Gaarder zu Gast, der weltberühmte Autor des Buches „Sofies Welt“. Jostein Gaarder sah aus wie der hübschere, gutmütigere Bruder des Gollum aus dem „Herrn der Ringe“. Wie dieser trug einer eine schüttere zerzauste Frisur auf seinem kugelrunden Kopf und sah aus wie ein Zwerg, der den Ring der Weisheit besaß und seine Zuhörer gerne daran teilhaben haben  lassen wollte. Sein neustes Buch trug den Titel „Genau richtig“ und handelte von dem Lehrer und Hobbyastronom Albert, der am Beginn des Buches erfährt, dass er an einer tödlichen Krankheit leidet. Albert zieht sich in ein kleines Haus an einem norwegischen See zurück, um eine Lebensbeichte abzulegen und sich darauf vorzubereiten, mit seinem nahenden Ende selbstbestimmt umzugehen. Weil mich dieses Thema aus gegebenem Anlass brennend interessierte, notierte ich mir den Titel und erwarb das Buch schon am nächsten Tag in der Buchhandlung Böttger in Bonn.
lassen wollte. Sein neustes Buch trug den Titel „Genau richtig“ und handelte von dem Lehrer und Hobbyastronom Albert, der am Beginn des Buches erfährt, dass er an einer tödlichen Krankheit leidet. Albert zieht sich in ein kleines Haus an einem norwegischen See zurück, um eine Lebensbeichte abzulegen und sich darauf vorzubereiten, mit seinem nahenden Ende selbstbestimmt umzugehen. Weil mich dieses Thema aus gegebenem Anlass brennend interessierte, notierte ich mir den Titel und erwarb das Buch schon am nächsten Tag in der Buchhandlung Böttger in Bonn.
Da ich schon mal bei der ZEIT vorbeigeschaut hatte, wollte ich auch noch die FAZ besuchen. Zur FAZ besaß ich eine noch viel engere Bindung als zur ZEIT. Wie für viele meiner Generationsgenossen hatte die tägliche FAZ Lektüre für mich jahrzehntelang zu den Genüssen gehört, auf die ich nicht verzichten wollte. Wie gerne denke ich an meine glücklichen Lehrerjahre zurück, als ich im Lehrerzimmer mit meinen Buddies Thomas und Klaus Peter in den Pausen die neueste Ausgabe der FAZ durchdiskutierte. Aber auch die FAZ hatte sich unter dem unseligen Einfluss Frank Schirrmachers in ein Mainstreamblatt verwandelt. Die Halbierung ihrer verkauften Auflage war die Folge gewesen, und nach langem Zögern war auch ich ihr von der Fahne gesprungen. Manchmal schaute ich noch hinein, manchmal erkannte ich noch die alte Klasse, immer öfter aber auch erstaunlichen Flachsinn junger Redakteure, die „von links“ in die Redaktion strömten, um sie, wenn sie in die Jahre kamen, „nach rechts“ in Richtung „Junge Freiheit“ zu verlassen.
 Als ich den FAZ Stand erreichte, ging es um das neue Buch des US-Amerikaners Carl Benedikt Frey mit dem Titel „Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation“. Carl Benedikt Fey sah genauso aus wie man sich einen Professor in einem Woody Allen Film vorstellt, mittelgroß, eher schmächtig, Brille Glatze, scharfe Artikulation. Das Auditorium umfasste vielleicht gerade mal ein Dutzend Zuhörer, leerte sich allerdings im Laufe der Veranstaltung weiter, so dass bald kaum mehr Zuhörer als Akteure anwesend waren. Dabei hatte die FAZ eigens einen Übersetzer abgestellt, der die Fragen des Moderators und die Antworten des Wissenschaftlers aus dem Englischen übersetzte. Freys Grundthese war, dass technologischer Wandel in der Wirtschaftsgeschichte immer zuerst mit Einkommenseinbußen für die Masse der abhängig Beschäftigten verbunden gewesen war. „In the long run“, aber habe die Gesamtgesellschaft von den Innovationen profitiert. Kritisch sei, dass in dieser ersten Phase die Innovation selbst auf dem Spiel stehe, weil die Betroffenen mit Gewalt gegen den technologischen Wandel protestierten. Diese erste Phase bezeichnete der Autor als „Engels-Pause“. Unter „Engels-Pause“ verstand er den Pauperismus der Jahre 1770 bis 1840, als infolge der Industrialisierung in England Hunderttausende Menschen ihre Arbeit und ihr Auskommen verloren. Der Begriff „Engels-Pause“ bezog sich auf Friedrich Engels, der genau in dieser Epoche die Lage der arbeitenden Klassen in England
Als ich den FAZ Stand erreichte, ging es um das neue Buch des US-Amerikaners Carl Benedikt Frey mit dem Titel „Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation“. Carl Benedikt Fey sah genauso aus wie man sich einen Professor in einem Woody Allen Film vorstellt, mittelgroß, eher schmächtig, Brille Glatze, scharfe Artikulation. Das Auditorium umfasste vielleicht gerade mal ein Dutzend Zuhörer, leerte sich allerdings im Laufe der Veranstaltung weiter, so dass bald kaum mehr Zuhörer als Akteure anwesend waren. Dabei hatte die FAZ eigens einen Übersetzer abgestellt, der die Fragen des Moderators und die Antworten des Wissenschaftlers aus dem Englischen übersetzte. Freys Grundthese war, dass technologischer Wandel in der Wirtschaftsgeschichte immer zuerst mit Einkommenseinbußen für die Masse der abhängig Beschäftigten verbunden gewesen war. „In the long run“, aber habe die Gesamtgesellschaft von den Innovationen profitiert. Kritisch sei, dass in dieser ersten Phase die Innovation selbst auf dem Spiel stehe, weil die Betroffenen mit Gewalt gegen den technologischen Wandel protestierten. Diese erste Phase bezeichnete der Autor als „Engels-Pause“. Unter „Engels-Pause“ verstand er den Pauperismus der Jahre 1770 bis 1840, als infolge der Industrialisierung in England Hunderttausende Menschen ihre Arbeit und ihr Auskommen verloren. Der Begriff „Engels-Pause“ bezog sich auf Friedrich Engels, der genau in dieser Epoche die Lage der arbeitenden Klassen in England  untersucht hatte. Auch Karl Marx´ Katastrophenszenarium vom mörderischen Kapitalismus entstammte dieser ersten Depressionsphase. Allerdings hatten sich die Verhältnisse schon gebessert, als er 1867 sein Hauptwerk „Das Kapital“ publizierte.
untersucht hatte. Auch Karl Marx´ Katastrophenszenarium vom mörderischen Kapitalismus entstammte dieser ersten Depressionsphase. Allerdings hatten sich die Verhältnisse schon gebessert, als er 1867 sein Hauptwerk „Das Kapital“ publizierte.
Auch wir, führte der Autor weiter aus, befänden uns derzeit in einer Engels-Pause, wenngleich in einer vergleichsweise sehr milden Erscheinungsweise. Viele Berufsgruppen, etwa Taxifahrer, Bankangestellte oder ungelernte Arbeiter erleiden Einbußen durch Digitalisierung, Automation und Globalisierung. „In the long run“ aber werde alles gut. Man sehe es ja jetzt schon an den steigenden Durchschnittseinkommen, wobei sich allerdings – auch das ein typisches Merkmal der Engels-Pause – sich die Einkommensungleichheit zunächst vergrößere. Möglich, dass sich dieser „Gap“ in absehbarer Zeit wieder schließe. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, dachte ich. Der US-amerikanische Rost Belt und Donald Trump lassen grüßen.
 Dergleichen Denkanstöße durfte man bei Sascha Lobo nicht erwarten. Dafür war es aber erheblich bunter und voller. Schon eine Viertelstunde, bevor der Meister erschien, waren die Plätze im Auditorium fast völlig besetzt. Sascha Lobo ist Deutschlands Meisterblogger, und sein Markenzeichen, ein prachtvoller roter Irokesenkamm, ist Kult. Sein Buch, das heute auf der Agenda stand, trug den Titel „Realitätsschock. Zehn Lehren aus der Gegenwart“. Man durfte also gespannt sein, wie der Blogger Sascha Lobo die Welt erklärte. Der Moderator war ein braun gebrannter, ungemein gepflegter Herr, der Lobo duzte und sofort zur Sache kam. „Aus welchen Beweggründen heraus hast die dieses Buch verfasst und was bedeutet der Begriff Realitätsschock?“ fragte er. Lobo zögerte keine Sekunde, wie er überhaupt
Dergleichen Denkanstöße durfte man bei Sascha Lobo nicht erwarten. Dafür war es aber erheblich bunter und voller. Schon eine Viertelstunde, bevor der Meister erschien, waren die Plätze im Auditorium fast völlig besetzt. Sascha Lobo ist Deutschlands Meisterblogger, und sein Markenzeichen, ein prachtvoller roter Irokesenkamm, ist Kult. Sein Buch, das heute auf der Agenda stand, trug den Titel „Realitätsschock. Zehn Lehren aus der Gegenwart“. Man durfte also gespannt sein, wie der Blogger Sascha Lobo die Welt erklärte. Der Moderator war ein braun gebrannter, ungemein gepflegter Herr, der Lobo duzte und sofort zur Sache kam. „Aus welchen Beweggründen heraus hast die dieses Buch verfasst und was bedeutet der Begriff Realitätsschock?“ fragte er. Lobo zögerte keine Sekunde, wie er überhaupt  während des gesamten Gespräches so prompt und druckreif antwortete, als wäre sein Gehirn mit einem Extra-Prozessor ausgestattet. Der „Realitätsschock“, so Lobo, habe er zunächst einmal selbst erlitten und zwar am Ende einer „Selbsttäuschung“, der er erlegen sei. Denn, niemals habe er, Lobo, sich vorstellen könne, wie schnell und vollständig die uns bekannten politischen Strukturen innerhalb kurzer Zeit erschüttert werden könnten. Diese Erschütterung habe sich ab 2014/5 Bahn gebrochen, weswegen diese Jahre den wahren Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert markierten. Besonders die Wahl Donald Trumps und die Mehrheitsentscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, repräsentierten Ungeheuerlichkeiten, nach denen nichts mehr so sei wie vorher. Dass Lobo das 21. Jahrhundert erst mit 2014 beginnen ließ, rechtfertigte er mit der Theorie des „langen 19. Jahrhunderts“, das auch erst 1914 geendet habe, einem Begriff den er von Toynbee übernommen habe. Ich notierte: der Blogger liebt das Name-Dropping, auch wenn er es noch nicht ganz treffsicher handhabte, denn nicht Toynbee sondern Hobsbawm hatte den Begriff des langen 19. Jahrhunderts geprägt. Aber was soll diese Beckmesserei? Toynbee wie Hobsbawm gehörte doch Vor-Internet-Ära an, was in den Begriffen unserer schnelllebigen Zeit etwa so viel bedeutete wie „vor Christi Geburt“. Wir aber, so
während des gesamten Gespräches so prompt und druckreif antwortete, als wäre sein Gehirn mit einem Extra-Prozessor ausgestattet. Der „Realitätsschock“, so Lobo, habe er zunächst einmal selbst erlitten und zwar am Ende einer „Selbsttäuschung“, der er erlegen sei. Denn, niemals habe er, Lobo, sich vorstellen könne, wie schnell und vollständig die uns bekannten politischen Strukturen innerhalb kurzer Zeit erschüttert werden könnten. Diese Erschütterung habe sich ab 2014/5 Bahn gebrochen, weswegen diese Jahre den wahren Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert markierten. Besonders die Wahl Donald Trumps und die Mehrheitsentscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, repräsentierten Ungeheuerlichkeiten, nach denen nichts mehr so sei wie vorher. Dass Lobo das 21. Jahrhundert erst mit 2014 beginnen ließ, rechtfertigte er mit der Theorie des „langen 19. Jahrhunderts“, das auch erst 1914 geendet habe, einem Begriff den er von Toynbee übernommen habe. Ich notierte: der Blogger liebt das Name-Dropping, auch wenn er es noch nicht ganz treffsicher handhabte, denn nicht Toynbee sondern Hobsbawm hatte den Begriff des langen 19. Jahrhunderts geprägt. Aber was soll diese Beckmesserei? Toynbee wie Hobsbawm gehörte doch Vor-Internet-Ära an, was in den Begriffen unserer schnelllebigen Zeit etwa so viel bedeutete wie „vor Christi Geburt“. Wir aber, so  Lobo immer wieder, leben in der Epoche des Cybernets, das unglaubliche Chancen aber auch Gefahren beinhalte. So habe es „Hass und Hetze“ zwar immer schon gegeben, das Netz aber verstärke diese Tendenzen durch die Eröffnung weltweiter Resonanzräume. Da konnte ich ihm nur zustimmen. Hatte Jürgen Habermas in seiner Habilitationsschrift „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ noch davon geschwärmt, dass die Zukunft der Demokratie in der fortschreitenden Ausweitung der Kommunikationsgemeinschaften liegen würde, zeigte die Praxis des weltweiten Internets, dass sich die rechts- und linksradikalen Drecksäcke aller Länder vereinigten, um seine Möglichkeiten zu missbrauchen. Um diesen und anderen Gefahren zu entgehen, empfahl Lobo seinen Lesern „zehn Lehren“, deren Quintessenz in der Aufforderung bestand, mit der Digitalisierung und dem Netz effektiver umzugehen, was immer das auch heißen mochte. Man müsse sich für die Zukunft „wappnen“, fügte er hinzu. Wappnen wovor? fragte ich mich. Vor den Shit-Stormern im Netz oder vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Vor Rechten, Linken, Islamisten oder Nanny-Bloggern wie ihm? Fragen über Fragen und wieder keine Antwort. Das Nebulöse war überall.
Lobo immer wieder, leben in der Epoche des Cybernets, das unglaubliche Chancen aber auch Gefahren beinhalte. So habe es „Hass und Hetze“ zwar immer schon gegeben, das Netz aber verstärke diese Tendenzen durch die Eröffnung weltweiter Resonanzräume. Da konnte ich ihm nur zustimmen. Hatte Jürgen Habermas in seiner Habilitationsschrift „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ noch davon geschwärmt, dass die Zukunft der Demokratie in der fortschreitenden Ausweitung der Kommunikationsgemeinschaften liegen würde, zeigte die Praxis des weltweiten Internets, dass sich die rechts- und linksradikalen Drecksäcke aller Länder vereinigten, um seine Möglichkeiten zu missbrauchen. Um diesen und anderen Gefahren zu entgehen, empfahl Lobo seinen Lesern „zehn Lehren“, deren Quintessenz in der Aufforderung bestand, mit der Digitalisierung und dem Netz effektiver umzugehen, was immer das auch heißen mochte. Man müsse sich für die Zukunft „wappnen“, fügte er hinzu. Wappnen wovor? fragte ich mich. Vor den Shit-Stormern im Netz oder vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Vor Rechten, Linken, Islamisten oder Nanny-Bloggern wie ihm? Fragen über Fragen und wieder keine Antwort. Das Nebulöse war überall.
Plötzlich fiel mir auf, dass mein diesjähriger Buchmessenbesuch eine starke  Sachbuchschlagseite hatte, wenn man denn Neubauer, Alt oder Lobo als Sachbuchautoren ansprechen wollte. Deswegen legte ich beim ARD Forum einen Boxenstopp ein, in dem gerade Karen Köhler ihren Roman „Miroloi“ vorstellte. Wieder sah die Autorin ausgesprochen gut aus, war eloquent und charmant und kam ausgesprochen cool rüber. Landesweit bekannt geworden war Karen Köhler im Jahre 2014, als sie wegen einer Windpockenerkrankung nicht zum Ingeborg Bachmann Wettbewerb nach Klagenfurt anreisen konnte und ihre Kollegen für die Abwesende eine Solidaritätslesung organisiert hatten. Leider war auch hier die eigentliche Lesung bereits zu Ende, und das Nachgespräch hatte begonnen, bei dem Frau Köhler zunächst Einblicke in ihre Arbeitsweise gewährte. Wenn ich sie recht verstanden habe, dann konzipierte, sinnierte und schrieb sie dies und das, ehe sie ihre Prosa-Fragmente an zwei Personen ihres Vertrauens schickte und fragte: „Ist das eine Geschichte, die von mir erzählt werden muss?“ So verhielt es sich
Sachbuchschlagseite hatte, wenn man denn Neubauer, Alt oder Lobo als Sachbuchautoren ansprechen wollte. Deswegen legte ich beim ARD Forum einen Boxenstopp ein, in dem gerade Karen Köhler ihren Roman „Miroloi“ vorstellte. Wieder sah die Autorin ausgesprochen gut aus, war eloquent und charmant und kam ausgesprochen cool rüber. Landesweit bekannt geworden war Karen Köhler im Jahre 2014, als sie wegen einer Windpockenerkrankung nicht zum Ingeborg Bachmann Wettbewerb nach Klagenfurt anreisen konnte und ihre Kollegen für die Abwesende eine Solidaritätslesung organisiert hatten. Leider war auch hier die eigentliche Lesung bereits zu Ende, und das Nachgespräch hatte begonnen, bei dem Frau Köhler zunächst Einblicke in ihre Arbeitsweise gewährte. Wenn ich sie recht verstanden habe, dann konzipierte, sinnierte und schrieb sie dies und das, ehe sie ihre Prosa-Fragmente an zwei Personen ihres Vertrauens schickte und fragte: „Ist das eine Geschichte, die von mir erzählt werden muss?“ So verhielt es sich 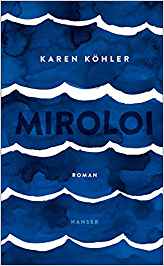 auch bei dem vorliegenden Roman, und da die Antwort uneingeschränkt positiv ausgefallen war, hatte sich Frau Köhler ans Werk gemacht. Herausgekommen war „Miroloi“, ein Brummer von sage und schreibe 500 Seiten, der es immerhin fertig gebracht hatte, das deutsche Feuilleton zu entzweien. Während die Literaturkritiker, die auf der feministischen Schiene unterwegs waren, die Symbolkraft und den Plot des Romans über den grünen Klee lobten, sprachen andere von einem „Kinderbuch für junge Leute ab 14“.
auch bei dem vorliegenden Roman, und da die Antwort uneingeschränkt positiv ausgefallen war, hatte sich Frau Köhler ans Werk gemacht. Herausgekommen war „Miroloi“, ein Brummer von sage und schreibe 500 Seiten, der es immerhin fertig gebracht hatte, das deutsche Feuilleton zu entzweien. Während die Literaturkritiker, die auf der feministischen Schiene unterwegs waren, die Symbolkraft und den Plot des Romans über den grünen Klee lobten, sprachen andere von einem „Kinderbuch für junge Leute ab 14“.
Der Roman Miroloi spielte auf einer archaischen griechischen Insel, auf der die Frauen extrem unterdrückt wurden. Auf dieser Insel kommt ein Findelkind zur Welt (natürlich ein Mädchen), dessen Werdegang der Roman minutiös nachzeichnet und zwar ambitionierterweise so, dass die Sprache des Romans sich dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes anpasst. In den Altersstufen, in denen das Kind noch keinen Konjunktiv beherrschte, muss auch der Text ohne Konjunktive auskommen. Erst später, mit dem Wachsen der reflektierten Weltzuwendung wird auch die Sprache des Buches reflexiver. Man hat also einen durchaus anspruchsvollen Roman vor sich, ließ der Moderator durchblicken, was im Klartext bedeutete, dass Leser ohne ein gerütteltes Maß an Lese- und  Leidensfähigkeit die Finger von diesem Buch lassen sollten. Wahrscheinlich durfte das noch nicht einmal als Kritik verstanden werden, denn hatte nicht Arno Schmidt dereinst in einem Brief an Hans Werner Richter den bedenkenswerten Satz formuliert: „Der allgemein verbreitete Irrtum beim Leser ist, weil er lesen kann, könne er auch jedes Buch lesen“. Angewendet auf Karen Köhlers „Miroloi“ würde das bedeuten, dass Bücher Bergen gleichen, die ja auch nicht jeder besteigen kann. Ich selbst bin nie höher gekommen als sechstausend Meter, und Bücher, die im metaphorischen Sinne Achttausender darstellten, werden mir nach Arno Schmidt für immer verschlossen bleiben.
Leidensfähigkeit die Finger von diesem Buch lassen sollten. Wahrscheinlich durfte das noch nicht einmal als Kritik verstanden werden, denn hatte nicht Arno Schmidt dereinst in einem Brief an Hans Werner Richter den bedenkenswerten Satz formuliert: „Der allgemein verbreitete Irrtum beim Leser ist, weil er lesen kann, könne er auch jedes Buch lesen“. Angewendet auf Karen Köhlers „Miroloi“ würde das bedeuten, dass Bücher Bergen gleichen, die ja auch nicht jeder besteigen kann. Ich selbst bin nie höher gekommen als sechstausend Meter, und Bücher, die im metaphorischen Sinne Achttausender darstellten, werden mir nach Arno Schmidt für immer verschlossen bleiben.
Aber zurück zum Interview und dem Moderator, der Karen Köhler fragte, ob ihr eigentlich schon während des Schreibens bewusst gewesen sei, wie sehr sie sich mit ihren Werk auf Tuchfühlung mit dem Zeitgeist befände. Das sagte er mit warmer freundlicher Stimme, so dass der Subtext gar nicht weiter auffiel, der für mich wie folgt klang: Ist es denn wirklich notwendig, nach so vielen feministischen Romanen noch einen feministischen Roman auf den Markt zu werfen? Die Autorin schien diesen Doppelsinn der Moderatorenfrage nicht zu bemerken und antwortete treuherzig, dass sie durchaus gemerkt habe, dass der Zeitgeist ihr Buch „einhole“, was mir wie eine charmante Umkehrung der Tatsache erschien, dass die Autorin mit ihrem Roman im Wahrheit dem Zeitgeist hinter hechelte und zwar so gekonnt, dass es ihr mit seiner Hilfe gelungen war, mit „Miroloi“ auf die Longlist des deutschen Buchpreises zu gelangen.
Ganz am Ende ging ich wieder dahin, wo die bösen Bücher lagerten, in die Sackgasse in Halle 4, in der die Verlage „Junge Freiheit“, „Manuscriptum“ und „Antaios“ verbannt worden waren. Vielleicht wäre ich gar nicht hingegangen, wenn diese Verlage nicht schon wieder in derart entwürdigender Weise unter Kuratel gestellt worden wären. Von Polizisten und Videoaufzeichnungsgeräten umgeben, vom normalen Laufverkehr abgeschnitten, durften die Mitarbeiter dieser Verlage in der Sackgasse genau das Ausmaß an öffentlicher Meinungsvielfalt leben, die ihnen der herrschende Kulturmarximus zugestand, d.h. sie durften sich zwar zur Schau stellen, es wurde aber dafür gesorgt, dass fast niemand sie sah.
Am Ende der Sackgasse war der deutsch-belgische Althistoriker David Engels am Stand der Jungen Freiheit zu Gast und wurde von Mathias Bäkermann  interviewt. David Engels war schon in jungen Jahren mit seinem Buch „Auf dem Weg ins Imperium“ bekannt geworden, indem er den Niedergang der europäischen Union mit dem Ende der römischen Republik verglich. Was mich an seinem Buch besonders interessiert hatte, waren seine Hinweise auf die moralische Verwahrlosung der politischen Elite als Ursache des Niedergangs – im spätrepublikanischen Rom durch die „Hellenisierung der Oberschicht“ und in der europäischen Union durch den fast
interviewt. David Engels war schon in jungen Jahren mit seinem Buch „Auf dem Weg ins Imperium“ bekannt geworden, indem er den Niedergang der europäischen Union mit dem Ende der römischen Republik verglich. Was mich an seinem Buch besonders interessiert hatte, waren seine Hinweise auf die moralische Verwahrlosung der politischen Elite als Ursache des Niedergangs – im spätrepublikanischen Rom durch die „Hellenisierung der Oberschicht“ und in der europäischen Union durch den fast  vollständigen Dispens traditioneller „bürgerlicher Werte“. Die Feste des Lukullus auf der einen und die Orgien des Paolo Pinkel mit ukrainischen Zwangsprostituierten auf der anderen Seite. Konnte man das wirklich vergleichen? Auf der anderen Seite wurde die römische Republik durch das Principat des Augustus in einer durchaus fortschrittlichen und positiven Weise „erlöst“. Duften wir das auch für die europäische Union erwarten?
vollständigen Dispens traditioneller „bürgerlicher Werte“. Die Feste des Lukullus auf der einen und die Orgien des Paolo Pinkel mit ukrainischen Zwangsprostituierten auf der anderen Seite. Konnte man das wirklich vergleichen? Auf der anderen Seite wurde die römische Republik durch das Principat des Augustus in einer durchaus fortschrittlichen und positiven Weise „erlöst“. Duften wir das auch für die europäische Union erwarten?
David Engels neues Buch „ Renovatio Europae“, das eigentlich ein Sammelband mit Beiträgen verschiedener Autoren war, intendierte ein neuartiges Verständnis der europäischen Einigung. Engels bezeichnete sein Konzept als „hesperialistisches Europa“, d.h. als ein Europa, das strikt auf den traditionellen „westlichen“  Werten beruhte und sich vom „universalistischen“ Europa der Europäischen Union abgrenzte. Das hesperialistische Europa stellte sich Engels als ein föderales Europa vor, in dem souveräne Nationalstaaten als Bauelemente erhalten blieben. Die Pointe dieses Ansatzes lag darin, dass Engels damit der neuen Rechten einen übernationalen Horizont zuwies, der durch die Klammer der gemeinsamen abendländisch-christlich-jüdischen Geschichte definiert war. Dieses hesperialistische Europa sollte vorwiegend subsidiär agieren und nur übernationale Aufgaben wie Infrastruktur und Verteidigung an eine europäische Zentrale delegieren. Insofern glich das hesperialistische Europa dem „Europa der Vaterländer“ wie es De Gaulle vorgeschwebt hatte, allerdings prägnant geprägt durch den Rekurs auf Religion, gemeinsame Kultur, Familie, Rechtstaatlichkeit und sozialen Ausgleich. Dieses politische Design wurde nach Engels Meinung derzeit auf nationaler Ebene am ehesten durch die polnische PiS Partei
Werten beruhte und sich vom „universalistischen“ Europa der Europäischen Union abgrenzte. Das hesperialistische Europa stellte sich Engels als ein föderales Europa vor, in dem souveräne Nationalstaaten als Bauelemente erhalten blieben. Die Pointe dieses Ansatzes lag darin, dass Engels damit der neuen Rechten einen übernationalen Horizont zuwies, der durch die Klammer der gemeinsamen abendländisch-christlich-jüdischen Geschichte definiert war. Dieses hesperialistische Europa sollte vorwiegend subsidiär agieren und nur übernationale Aufgaben wie Infrastruktur und Verteidigung an eine europäische Zentrale delegieren. Insofern glich das hesperialistische Europa dem „Europa der Vaterländer“ wie es De Gaulle vorgeschwebt hatte, allerdings prägnant geprägt durch den Rekurs auf Religion, gemeinsame Kultur, Familie, Rechtstaatlichkeit und sozialen Ausgleich. Dieses politische Design wurde nach Engels Meinung derzeit auf nationaler Ebene am ehesten durch die polnische PiS Partei  repräsentiert, was auch die wütenden, teilweise maßlosen Angriffe westlicher Meinungsführer gegen die PiS erkläre. Deswegen sei es kein Zufall, dass er zurzeit in Polen lebe und arbeite, wo es ihm so gut gefiele, dass Polen mittlerweile für ihn so etwas wie ein zweites Vaterland geworden sei.
repräsentiert, was auch die wütenden, teilweise maßlosen Angriffe westlicher Meinungsführer gegen die PiS erkläre. Deswegen sei es kein Zufall, dass er zurzeit in Polen lebe und arbeite, wo es ihm so gut gefiele, dass Polen mittlerweile für ihn so etwas wie ein zweites Vaterland geworden sei.
Inzwischen war es Abend geworden im Abendland. Ich hatte genug gesehen und gehört, lief zur Bushaltestelle und fuhr zurück zum Rebstockparkplatz. Was hatte mir dieser Tag gebracht? Abgesehen von der Atmosphäre eines gewaltigen Bücherbazars, die für sich allein genommen schon fast einen Besuch wert ist, war ich wieder mit den literarischen Erscheinungsformen eines kulturmarxistischen Zeitgeistes konfrontiert worden, der in feministischen Romanen, Apell-Literatur und der sinnfreien „Fridays for Future“ Bewegung seiner paradoxen Übersteigerung entgegenlief. Wo ich noch vor einigen Jahren gedachte hatte, dass sich die Verhältnisse langsam normalisieren und bald wieder alle Positionen des weltanschaulichen Spektrums von rechts bis links gleichermaßen am gesamtgesellschaftlichen Diskurs würden teilnehmen können, hatten sich die Zustände weiter verhärtet. Die geschlossene Phalanx von Regierung, öffentlich-rechtlichem Rundfunk und regierungsaffiner Presse hatte den Meinungskorridor in einer Weise eingeengt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Innerhalb dieses Meinungskorridors dominierte ein Gemisch aus hemmungslosem Selbstlob und intellektueller Dürftigkeit. Aber spielte das überhaupt noch eine Rolle? Wurden Niveau und Realität, Begründungen und Wahrheit nicht immer unwichtiger, weil große Teile des sogenannten „gebildeten Publikums“ in ihrer Kernkompetenz unsicher geworden waren – eben der Kernkompetenz zwischen Sinn und Unsinn zu unterscheiden?

