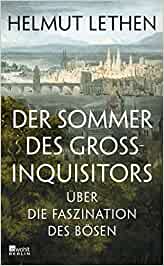 Das Böse hat viele Namen. Etwas hausbacken kommt es als „Satan“, „Teufel“ oder „Luzifer“ daher, neuerdings auch als „Rassismus“, „Hass“, „Hetze“ oder „Diskriminierung“. Gerne tarnt sich das Böse auch als sein Gegenteil, getreu der Sentenz von Ignazio Silone: „Der neue Faschismus wird nicht sagen: ich bin der Faschismus. Er wird sagen: ich bin der Antifaschismus.“ Bei so viel Mimikry mag sich mancher fragen: Was ist der Grund seines Wesens? Ist das Böse nur die Abwesenheit des Guten oder besitzt es eine eigene Entität, die als Weltprinzip dem Guten gegenübertritt?
Das Böse hat viele Namen. Etwas hausbacken kommt es als „Satan“, „Teufel“ oder „Luzifer“ daher, neuerdings auch als „Rassismus“, „Hass“, „Hetze“ oder „Diskriminierung“. Gerne tarnt sich das Böse auch als sein Gegenteil, getreu der Sentenz von Ignazio Silone: „Der neue Faschismus wird nicht sagen: ich bin der Faschismus. Er wird sagen: ich bin der Antifaschismus.“ Bei so viel Mimikry mag sich mancher fragen: Was ist der Grund seines Wesens? Ist das Böse nur die Abwesenheit des Guten oder besitzt es eine eigene Entität, die als Weltprinzip dem Guten gegenübertritt?
Um die Wahrheit zu sagen: das vorliegende Buch „Der Sommer des Großinquisitors“ des Literaturwissenschaftlers Helmut Lethen gibt darauf auch keine Antwort. Es portraitiert vielmehr eine Facette des Bösen, das sich unter Umständen sogar als eine Abart des zerzausten Guten erweisen kann. Aber der Reihe nach.
Lethen wählt als Ausgangspunkt seiner Überlegungen über „die Faszination des Bösen“ die Legende vom Großinquisitor aus dem Roman „Die Brüder Karamasow“ von Fjodor Dostojewski. In dieser Parabel wird erzählt, wie Jesus auf die Erde zurückkehrt, bezeichnenderweise nicht nach Petersburg oder Jerusalem, sondern in das Spanien der Inquisition. Obwohl er als Heiland von allen erkannt wird, lässt ihn der Großinquisitor verhaften und einkerkern. In einem nächtlichen Kerker-Dialog, der eigentlich ein langer Monolog ist, erklärt der Großinquisitor Jesus, dass seine Rückkehr die Ordnung der Welt gefährde. Nicht Liebe und Freiheit, wie Jesus sie gepredigt habe, sondern Herrschaft und Ordnung seien für die menschliche Zivilisation elementar. Da der zurückgekehrte Jesus diese Ordnung störe, werde er als Ketzer verbrannt. Am Ende dieses Monologs erhebt sich Jesus wortlos, küsst den Großinquisitor „still auf die blutleeren neunzigjährigen Lippen,“ wird aus dem Kerker entlassen und verschwindet in der Nacht.
Auf den ersten Blick erscheint der Großinquisitor tatsächlich als ein getarnter Satan, der sich auf das Unheilvollste innerhalb der Kirche breit gemacht hat. Aber nur auf den ersten Blick, denn Lethen glaubt zu erkennen, dass der Großinquisitor die historischen Erfahrungen auf seiner Seite hat und ein durch und durch realistisches Herrschaftsverständnis repräsentiert. Hoppla, denkt der Leser: geht der Autor hier etwa dem freiheitsfeindlichen Satan auf den Leim? Weil sich Lethen selbst nichtganz sicher zu sein scheint, entschließt er sich, seine Mutmaßung durch einen Galoppritt durch die Geistesgeschichte der letzten anderthalb Jahrhunderte zu überprüfen. Dieser Ritt führt ihn von Helena Blavatsky zu Wladimir Solowjow, von den Schwarzen Messen und diversen Antichristen, über Max Weber, Carl Schmitt und den Nationalsozialismus bis hin zum Stalinismus und Arthur Koestlers „Sonnenfinsternis“. Bei diesem Parquour gibt es manche Überraschung, sogar für den Autor selbst, der sein Publikum gerne an seiner Verblüffung teilhaben lässt, manchmal aber auch für den Leser, der bei dem einen oder anderen geisteswissenschaftlichen Shortcut ins Schleudern gerät.
Ohne die Analysen hier im Detail nachzeichnen zu können, ergibt sich am Ende doch immer der gleiche Befund: Der Großinquisitor erscheint gleichsam als ein Verantwortungsethiker mit dem Pferdefuß, der um die Abgründe gesinnungsethischer Herrschaft weiß und das seine tut, um das Schlimmste zu verhindern. Dabei gehen die Fronten oft kunterbunt durcheinander: mal erscheint Jesus als ein Gesinnungsethiker, wenngleich sein Reich nicht von dieser Welt ist, wodurch es gottlob nicht zum Schlimmsten kommt. Reine innerweltliche Gesinnungsethiker waren Nazis und Kommunisten, weil ihre Ethik notwendig in den Terror führte. Ein Schelm, wer hier an die Gesinnungsethik der Grünen denkt.
Wer hier einwendet, das könne doch unmöglich die Intention gewesen sein, die Dostojewski bei der Abfassung seiner Legende vom Großinquisitor verfolgt habe, der liegt goldrichtig. Es gehört zu den größten Stärken des vorliegenden Buches, dass sich Lethen immer der Differenz zwischen der Richtung seiner Erörterung und dem Anliegen Dostojewski bewusst bleibt. Denn Dostojewski offeriert in der Gestalt von Fürst Myschkin eine ganz andere Lösung des Herrschaftsproblems Fürst Myschkin, die Hauptfigur aus Dostojewskis Roman „Der Idiot“, ist in seiner Jesushaftigkeit der wahre Widerpart des Großinquisitors, denn er ist unfähig zur Feindschaft und bedarf deswegen keiner Herrschaft, in welcher Form auch immer. In einer Welt voller Myschkins brauchte es deswegen auch keinen Großinquisitor mehr. Bis es aber so weit ist, wird die Welt noch etwas warten müssen. Möglicherweise bis zum Jüngsten Gericht.