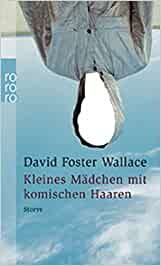 David Foster Wallace ist in aller Munde – besonders nachdem er den Riesenroman „Infinitive Jest“ fertigggestellt und sich anschließend erschossen hat. Bevor ich mich an das allseits gelobte aber über tausendseitiges Opus Magnum herantraute, wollte ich erst etwas Einführendes lesen, und so griff ich zu der Story-Sammlug „Kleines Mädchen mit komischen Haaren“, einem Werk des frühen John Foster Wallace, dass er als Endzwanziger 1989 veröffentlichte.
David Foster Wallace ist in aller Munde – besonders nachdem er den Riesenroman „Infinitive Jest“ fertigggestellt und sich anschließend erschossen hat. Bevor ich mich an das allseits gelobte aber über tausendseitiges Opus Magnum herantraute, wollte ich erst etwas Einführendes lesen, und so griff ich zu der Story-Sammlug „Kleines Mädchen mit komischen Haaren“, einem Werk des frühen John Foster Wallace, dass er als Endzwanziger 1989 veröffentlichte.
Das Buch besteht aus insgesamt fünf Geschichten, die zwischen knapp dreißig Seiten bis etwa sechzig Seiten lang sind. Es handelt sich im Prinzip um lauter kleine Romanen in nuce, in denen ein Plot entfaltet und lZivilisationskritik von verschiedenen Standpunkten aus durchgespielt wird. In formaler Hinsicht chargieren sie zwischen einer konventionellen Erzählweise und postmodernen Darstellungsmethoden. So geht es etwa bei der Titelstory „Kleines Mädchen mit komischen Haaren“, um die Innenansicht einer Punkergruppe, die ein Keith Jarrett Konzert („ein Neger, der sehr gut Klavier spielt“) besucht. In „Tiere sehen Dich an“ wird die Geschichte einer Jeopardy-Großmeisterin erzählt, die alle ihre Gewinne für die Therapie ihres autistischen Bruders ausgibt, bis sie eben diesem am Ende in der letzten Jeopardy Sitzung unterliegt. „John Billy“ beschreibt Aufstieg und Fall des rustikalen Chuck Nunn Junior („Mit zehn schon Haare am Sack, Bart mit zwölf, Ö-Beine wie ein Cowboy und scharf wie eine Wüstenratte“) im Unterschichtenjargon. „Mein Auftritt“ dreht sich um einen Besuch der David Lettermann Show, und die Abschlussgeschichte „Lyndon“ bietet dem Leser einen Blick auf das Leben des amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson – aus der Sicht eines homosexuellen Zuarbeiters.
Man muss nicht sonderlich lange lesen, bis man begreift, dass man in der vorliegenden Story-Sammlung tatsächlich etwas Besonders vor sich hat. Die Weite der Themen, der sprachliche Zugriff, besonders in der Punker-Story und der Chuck-Nunn-Geschichte, sind befremdend und faszinierend zugleich. Wie alle Adepten der literarischen Postmoderne spart auch Wallace nicht mit Tabubrüchen und Schocks, aber in seinen Geschichten erscheinen sie nirgendwo aufgesetzt sondern durchweg als stimmige Elemente einer durch und durch skurrile Wirklichkeit, mit der der Leser in ganz anderer Weise als sonst in eine gerade schmerzlich intensive Tuchfühlung ( postmodern: Buch-fühlung) gerät.
Gibt es denn bei diesem Jung-Genie gar nichts zu kritisieren? Meiner Ansicht nach nicht viel, wenn man einmal von der immer recht abrupten Schlussgestaltung absieht. Alle Geschichten enden wie ein Loch in der Wirklichkeit, sie sind auf eine aufreizende Weise unvollständig, – was Wallace Fans allerdings nicht verwundern wird, weil doch bekanntermaßen Fragmentparität zum Grundrepertoire der Postmoderne gehört. Es handelt sich aber bei den vorliegenden frühen Geschichten des Meisters ein wenig um eine Fragementalität mit Ansage, d. h. die schlussendliche Offenheit der Erzählungen eröffnet keinen plausiblen Verweisungshorizont sondern bleibt doch sehr im Beliebigen. Allerdings würden Wallace-Jünger hier antworten, dass Beliebigkeit nichts weiter ist als der leere Kern der Welt, womit es wieder passt. Weiß der Geier, wer Recht hat.